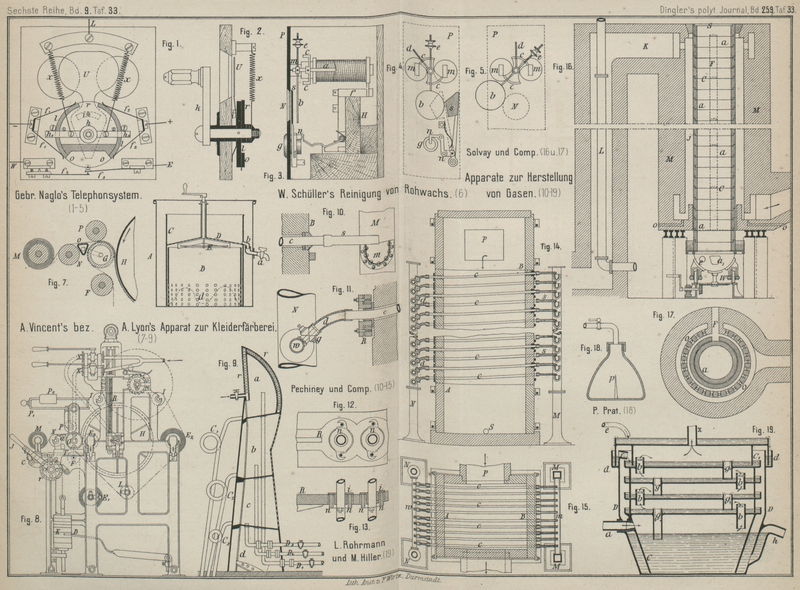| Titel: | Apparate zur Herstellung und Verarbeitung von Gasen. |
| Fundstelle: | Band 259, Jahrgang 1886, S. 508 |
| Download: | XML |
Apparate zur Herstellung und Verarbeitung von
Gasen.
Patentklasse 12. Mit Abbildungen auf Tafel 33.
Apparate zur Herstellung und Verarbeitung von Gasen.
Der Kühler für Metall angreifende Gase, namentlich Chlor
und Salzsäure, von A. R. Pechiney und Comp. in
Salindres (* D. R. P. Nr. 34397 vom 31. Mai 1885) besteht aus einem Steinthurme mit
von kaltem Wasser durchflossenen Glasröhren als Kühlmittel. Diese Glasröhren c (Fig. 10 bis 15 Taf. 33)
ragen mit ihren Enden aus den Seiten des Thurmes heraus. Auf der einen Seite A ist jedes Glasrohr durch einen Kautschukschlauch d mit einer Röhre w
verbunden, welche von der hohlen Säule N mit Wasser
versorgt wird (Fig.
10). Auf der anderen Seite B flieſst das
Wasser wieder durch Schlauchansätze s in Rinnen m, aus denen es durch die hohle Säule M abgeleitet wird (Fig. 11). Damit die
Glasröhren c weniger leicht springen, müssen sie immer
mit Wasser gefüllt bleiben und läſst man sie daher etwas ansteigen. Da die sich an
der Oberfläche der Röhren c verdichtende saure
Flüssigkeit nach dem Ende A flieſst, so müssen hier die
Fugen gut gedichtet werden. Zu diesem Zwecke sitzt auf dem durchgehenden Ende des
Glasrohres ein kurzes Kautschukrohr i mit Flansche
(vgl. Fig. 12
und 13),
welche gegen den Stein durch den röhrenförmigen Theil der Stopfbüchse n fest angedrückt wird. Das Anziehen der Stopfbüchse
geschieht durch Schrauben, welche durch ihre ringförmige Flansche hindurchgehen und
in Gewinde, welche in die Schiene R eingeschnitten
sind, greifen. Die zu kühlenden Gase oder Dämpfe werden am besten nahe an der Decke
des Thurmes, etwa bei P, eingeführt und treten dann
nahe am Boden auf der entgegengesetzten Seite wieder aus. Die etwa im Thurme
condensirte Flüssigkeit läuft durch die Oeffnung S
aus.
Wenn eine der Glasröhren c zerbricht, so kann dieselbe,
sehr schnell und ohne die Thätigkeit des Apparates zu stören, entfernt und durch
eine neue Röhre ersetzt werden. Ob eine Röhre zerbrochen ist, merkt man durch die
Vermehrung der aus S ausflieſsenden Flüssigkeit und man
sieht leicht, welche Röhre es ist, da dann aus ihrem durch B hindurchgehenden Ende kein Wasser mehr ausflieſsen wird. Der Hahn g, welcher zu ihr gehört, wird sofort geschlossen, die
zerbrochene Röhre herausgenommen und eine neue eingesetzt, ohne die Thätigkeit des
Apparates zu unterbrechen.
Nach Solvay und Comp. in Brüssel (* D. R. P. Nr. 34404
vom 28. Juli 1885) wird zur Herstellung von Chlor durch
Erhitzen von Chloriden im Luftstrome eine stehende Retorte C (Fig.
16 und 17 Taf. 33) aus feuerfestem Thone verwendet, deren ringförmige Stücke a mit Falzen in einander greifen. Der Durchmesser der
Ringe nimmt von unten nach oben leicht ab, so daſs die Retorte eine etwas
kegelförmige Gestalt erhält, wodurch das Herabsinken der erhitzten Stoffe
erleichtert wird. Die Retorte ruht unten auf einem aus Metall hergestellten, auf
Rädern um eine senkrechte Achse beweglichen Wagen W,
welcher mittels eines Getriebes um sich selbst gedreht werden kann. Zweck dieser
Anordnung ist, die dem Rissigwerden stark ausgesetzte Retorte ohne Unterbrechung des
Prozesses an der Auſsenseite untersuchen und ausbessern zu können. Die Risse lassen
sich eben nicht verhindern und sind nach kurzem Gebrauche schon in solchem Umfange
vorhanden, daſs man an der Auslaſsöffnung kaum noch Gase abfängt. Um nun die
nöthigen Ausbesserungen an der Retorte im Ofen selbst vornehmen zu können, ist neben
der Drehbarkeit der Retorte noch in dem umgebenden äuſseren Mauerwerke M eine dasselbe von oben nach unten durchbrechende,
beim Nichtgebrauche geschlossene Oeffnung F vorgesehen,
vor welcher man die Retorte durch Drehung ihres Wagens W vorbeibewegt. Man könnte diese Oeffnung ohne Unbequemlichkeit auch
staffelförmig gestalten.
Bei der auf der Zeichnung dargestellten Anordnung würde man den Zufluſs der Gase
unterbrechen müssen, um die Retorte drehen zu können. Um dies zu vermeiden, hat man
die Achse des Wagens hohl zu machen und die Zuführung der Gase durch diese zu
bewirken, so daſs keinerlei Unterbrechungen des Betriebes stattzufinden braucht.
Ein Generator liefert das zum Erhitzen der Retorte erforderliche Gas und durch Kanäle
o tritt die Verbrennungsluft zu, während die
Verbrennungsgase durch den Zug K zur Esse entweichen.
Die zur Reaction innerhalb der Retorte nöthige Luft wird durch das im Zuge K niedersteigende Rohr L
eingetrieben und ist auf diese Weise schon vorgewärmt, wenn sie bei e unten in die Retorte eintritt. Die Beschickung findet
von oben statt, die Chlor haltigen Gase entweichen bei S, die ausgenutzten Stoffe werden bei a1 entfernt.
Um Gase durch eine Flüssigkeit zu lösen, steht nach L. Rohrmann in Krauschwitz und M. Hiller in Berlin (* D. R. P. Nr. 34398 vom 7. Juni 1885) der Rand des
flachen Gefäſses C (Fig. 19 Taf. 33) auf dem
Boden des äuſseren Gefäſses D. Das Gas tritt durch Rohr
a ein, streicht über die Löseflüssigkeit, der nicht
gelöste Rest zieht in der Pfeifrichtung durch die Rohre b nach oben und entweicht durch Rohr z. Die
Löseflüssigkeit gelangt durch Rohr e in das obere
Gefäſs C1, flieſst über
den Rand desselben in die Rinne d, dann durch Rohr f und die Ueberlaufrohre g
nach unten, um schlieſslich durch Rohr h
abzulaufen.
P. Prat in Lanildut, Frankreich (* D. R. P. Nr. 34023
vom 30. Mai 1885) will zur Entwickelung von Gasen
Gefäſse anwenden, welche, wie Fig. 18 Taf. 33 zeigt
durch eine Scheidewand p getheilt sind. Die
betreffenden Stoffe
werden getrennt in die einzelnen Abtheilungen eingefüllt, dann wird der Behälter
geschlossen und durch Schütteln in bekannter Weise die Gasentwickelung
eingeleitet.
Tafeln