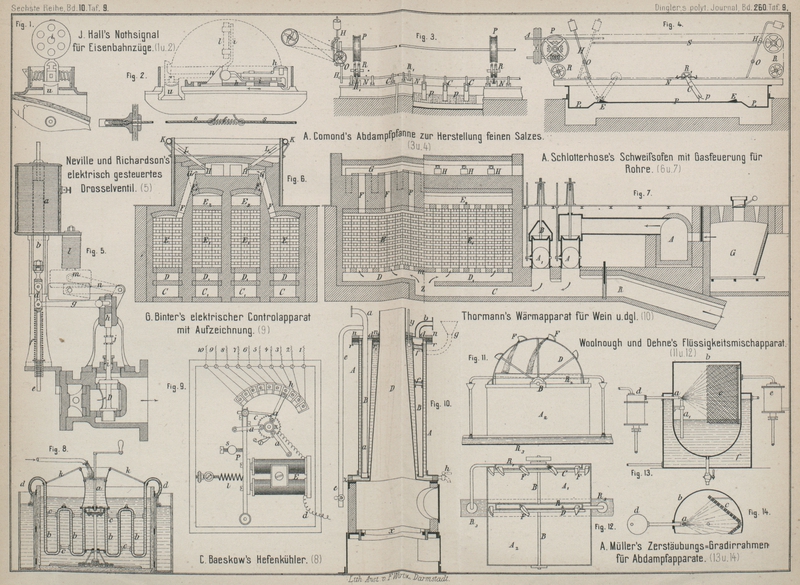| Titel: | Apparat zum Erwärmen gegohrener Getränke. |
| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 124 |
| Download: | XML |
Apparat zum Erwärmen gegohrener
Getränke.
Mit Abbildung auf Tafel
9.
Thormann's Wärmeapparat für gegohrene Getränke.
F.
Thormann in Wiesbaden (* D. R. P. Kl. 6 Nr. 34394 vom 5.
Mai 1885) legt Werth darauf, daſs sich die sogen. Pasteurisirapparate
leicht reinigen lassen. Ein solcher Apparat mit Wasserbad (vgl. Uebersicht 1885 255 * 290) hat deshalb, um denselben leicht aus einander
nehmen und wieder zusammen setzen zu können, die in Fig. 10 Taf. 9
veranschaulichte Einrichtung erhalten. Zur Bildung des Wasserbades wird der untere
Bord des kegelförmigen Flammrohres D mit dem
angelötheten Flanschringe des Blechcylinders A durch
einen Zwischenring z verbunden. In den also gebildeten
Wasserbehälter wird nun, nachdem auf den Bord des Cylinders A und einen am Rohre D auſsen angelötheten
Flanschring je ein Dichtungsring von Gummi oder Pappe gelegt wurde, der ringförmige
Behälter B für die zu erwärmenden Flüssigkeiten
eingehängt. Derselbe besteht aus einem äuſseren Cylinder von innen stark verzinntem
Kupferblech, welcher oben einen nach auſsen gehenden Bord trägt, während das untere
Ende nach innen umgebördelt wird, bis es an die Wandung des inneren Kegels reicht,
wo es mit letzterem verlöthet wird. Dieser innere, ebenfalls aus stark verzinntem
Kupferblech bestehende Kegel trägt oben eine breite, nach innen bis an das Flammrohr
reichende Umbördelung. Die beiden oberen Umbördelungen des Flüssigkeitsbehälters
legen sich nun beim Einhängen auf die oben erwähnten Dichtungsringe und schlieſsen
so das Wasserbad ab. Nunmehr kommen wieder zwei Dichtungsringe, auf welche sich
endlich ein starker, verzinnter ringförmiger Kupferdeckel d legt. Auf dem Deckel sind zwei den unter den oberen Bord des Cylinders
A und den Flanschring des Rohres D gelegten Ringen r und
r1 entsprechende
Ringe n und n1 befestigt, welche mittels Schrauben zum Abdichten
des Wasserbehälters als auch des Flüssigkeitsbehälters B dienen.
Beim Gebrauche füllt man zuerst durch einen Trichter g
den Wasserbehälter, bis das Wasser in dem Trichter steht. Dabei entweicht durch
aufgesetzte Röhrchen die in dem durch Einhängen des Flüssigkeitsbehälters B entstandenen inneren und äuſseren Cylinderraume des
Wasserbehälters enthaltene Luft. Nach Entzündung des Feuers auf dem Roste x wird das erwärmte Wasser des inneren Ringes zwischen
beiden Kegeln rasch in die Höhe steigen und durch die beiderseits eingelötheten
Rohre f durch den Behälter B hindurch nach dem äuſseren Wasserbadringe steigen, um, etwas kühler
geworden, wieder nach unten zu sinken, bis das Wasser gleichmäſsig heiſs ist. Die
durch Rohr a eingeführte Flüssigkeit erwärmt sich dann
sehr schnell auf die gewünschte Temperatur, welche das Thermometer y anzeigt und flieſst bei b ab. Nach beendigter Arbeit wird die in dem Behälter B bleibende Flüssigkeit mit Hilfe des Heberohres e völlig abgelassen, während das Wasserbad durch Hahn
h abflieſsen kann.
Tafeln