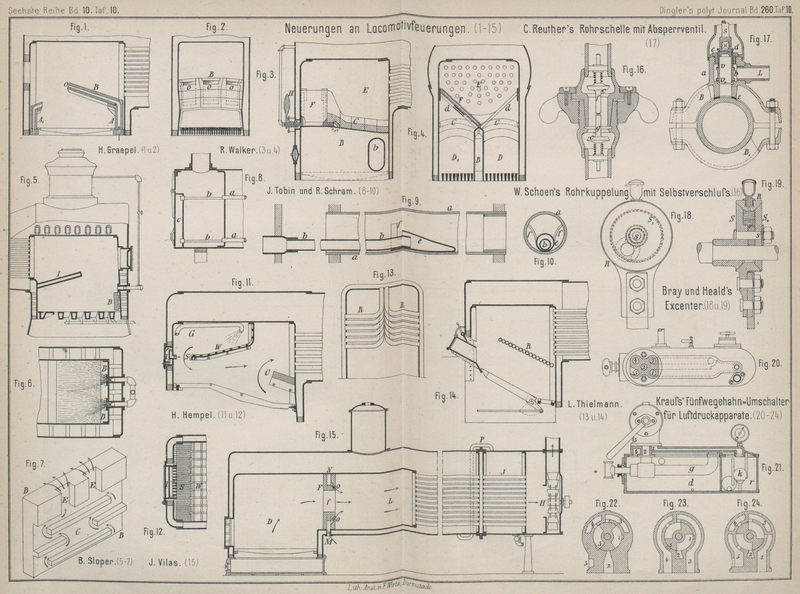| Titel: | Ueber Neuerungen an Locomotivfeuerungen. |
| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 157 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen an Locomotivfeuerungen.Vgl. Neuerungen an Dampfkesselfeuerungen 1883 248 *
221.
Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 10.
Ueber Neuerungen an Locomotivfeuerungen.
Die nachstehend beschriebenen neueren Feuerungen für Locomotiven lehnen sich zum
Theile an die Nepilly'sche Feuerung (vgl. 1882 243 * 283) an, zum Theile bezwecken sie eine geeignete
Zuführung und Vorwärmung der Luft behufs Rauchverminderung.
Bei der in Fig.
1 und 2 Taf. 10 abgebildeten Anordnung von H. Graepel in
Buda-Pest (* D. R. P. Nr. 24865 vom 25. Mai 1883) ist die nach hinten zurückgezogene
Brücke B hohl ausgeführt und dient zur Zuführung von
Luft. Hierdurch wird einerseits eine günstige Vorwärmung der Luft, andererseits aber
eine zweckmäſsige Kühlung der Brücke erreicht, so daſs
die letztere weniger schnell zerstört werden wird. Die Brücke ist aus einzelnen, mit
Kanälen o versehenen Chamottesteinen zusammengesetzt
und schlieſst sich an den auf zwei Rostträgern stehenden Hohlkörper A an. Wesentlich ist es, die Brücke B der Hinterwand der Feuerbüchse nicht zu nahe zu
bringen, damit die Feuerthür und ihre Umgebung nicht zu sehr leide (vgl. 1883 248 223). Unter Umständen soll unterhalb der Feuerthür,
dem Hohlkörper A gegenüber, noch ein ähnlicher
Hohlkörper A1
aufgestellt werden, um die innige Mischung der Gase mit der Luft noch mehr zu
befördern.
In Fig. 5 bis
7 Taf. 10
ist eine Feuerung von B. Sloper in New-York (Erl. * D.
R. P. Nr. 26849 vom 19. September 1883) dargestellt, bei welcher die Brücke I in
bekannter Weise aus Blech hergestellt und mit dem Wasserraume des Kessels verbunden
zu sein scheint. Das Patent bezieht sich nicht auf diese Brücke, sondern auf eine
Vorrichtung zum Einblasen der Luft mittels
Dampfstrahles. An der Hinterwand der Feuerbüchse ist dicht über dem Roste
eine mit Rippen versehene Platte B (Fig. 7) so befestigt, daſs
zwischen ihr und der Feuerbüchswand Kanäle C für die
Luft gebildet werden, welche oben bei E münden. Dicht
oberhalb dieser Mündungen sind von auſsen Düsen eingeführt, durch welche sehr dünne,
breite Dampfstrahlen etwas nach unten geneigt eingeblasen werden, wobei die Luft
durch die Kanäle C E angesaugt wird; es wird dabei auf eine
Zersetzung des Dampfes gerechnet. Jedenfalls hat hier die Brücke I mehr als unter anderen Umständen zu leiden.
R. L
Walker in Boston (* D. R. P. Nr. 22897 vom 11. Juli
1882) will das Prinzip der Doppelrostfeuerung in der durch Fig. 3 und 4 Taf. 10
veranschaulichten Weise bei Locomotiven anwenden. Eine flache Wasserkammer B scheidet den Feuerraum in zwei Kammern D und D1 welche bis auf eine kurze Strecke an der hinteren
Feuerbüchswand durch Gewölbesteine C abgedeckt sind.
Durch eine Klappe F können auch die gelassenen
Oeffnungen abwechselnd abgeschlossen werden und zwar geschieht dies immer bei der
frisch beschickten Kammer. Die in derselben sich massenhaft entwickelnden
Kohlenwasserstoffe sind dann gezwungen, durch die Oeffnung b der Zwischenwand in die andere Kammer zu treten und in dieser zwischen
den weiſsglühenden Kohlen und der jedenfalls sehr heiſsen Decke C hindurchzuziehen, um in die obere Kammer E zu gelangen. Durch Rohre d, welche gleichzeitig zur Unterstützung der Klappe F dienen, ist die Wasserkammer B mit den Seitenwänden der Feuerbüchse verbunden. Für jede der beiden
Kammern D und D1 ist eine besondere (nicht gezeichnete) Thür zur
Beschickung des Rostes vorhanden. Das Bedenklichste an der Sache ist die Einrichtung
der Klappe F, durch welche in Schlangenwindungen
hindurch von der Kammer B aus ein Wasserstrom nach dem
Kessel geleitet werden soll. Wie dabei eine dauernde Abdichtung der Drehachse
erreicht werden soll, ist nicht ersichtlich. Das Umlegen der Klappe von der einen
auf die andere Seite wird mittels des Handgriffes H
bewirkt.
Von L. H.
Thielmann in Braunschweig (* D. R. P. Nr. 28316 vom 3.
Januar 1884) rührt die in Fig. 13 und 14 Taf. 10
abgebildete Einrichtung her. Der schräge Rost, der Schüttkasten mit Luftklappe
u.s.w. sind nach Art der Tenbrink'schen Feuerung
angeordnet. Die vorgezogene Brücke wird durch winkelig gebogene Wasserröhren R gebildet, welche einerseits in den
Seitenwänden, andererseits in der Decke der Feuerkiste befestigt sind und in welchen
jedenfalls eine sehr kräftige Wasserströmung zu Stande kommen wird. Die Röhren,
namentlich die oben liegenden, sind trotzdem sehr der Zerstörung ausgesetzt und
werden häufige Auswechselung erfordern.
H. Hempel in Leipzig (Erl. * D. R. P. Nr. 30128 vom 5.
Juni 1884) hat in der Feuerbüchse eine besondere Entgasungskammer angebracht, wie in Fig. 11 und 12 Taf. 10
dargestellt ist. Dieselbe wird durch eine an die Feuerbüchsdecke sich anschlieſsende
Winkelplatte W gebildet, welche der Feuerthür gegenüber
einen Spalt S für den Durchgang der oberhalb W entwickelten Gase läſst. Auf diese Platte W werden die frischen Kohlen geschüttet. In der Thür,
durch welche man sowohl zum Roste, wie zu dem Entgasungsraume G gelangen kann, sind Kanäle l angeordnet, durch welche die Luft gerade an der engsten Stelle in die
aus G entweichenden Gase einströmt. Sobald die Kohlen
in G hinreichend entgast sind, werden sie auf den etwas geneigten Rost
gestoſsen, um hier zur vollständigen Verbrennung zu gelangen. Zur theilweisen
Rückziehung der Heizgase sowie zum Schütze der unteren Röhren ist an der Vorderwand
der Feuerbüchse ein Feuerschirm C angebracht. Durch
einen in die Kammer G eingeführten Dampfstrahl soll die
Verbrennung befördert werden. So zweckmäſsig der Grundgedanke dieser Einrichtung
sein mag, wird dieselbe doch kaum Anwendung finden, da die Feuerbüchse zu sehr
verbaut ist und die Röhren schlecht zugänglich sind.
Von J. Tobin und R. Schram in
London (* D.
R. P. Nr. 32430 vorn 9. Oktober 1884) wird die in Fig. 8 bis 10 Taf. 10 abgebildete
Einrichtung zur Luftzuführung in die Heizröhren in
Vorschlag gebracht. In jedes Heizrohr a ist ein enges
Luftzuführungsrohr b eingelegt, welches in der Nähe der
Feuerbüchse in einen die Luftströmung umkehrenden Schuh e mündet. Derselbe ist an dem Rohre b
befestigt und kann durch aufgebogene Arme f oder in
anderer Weise in dem Rohre a festgehalten werden.
Sämmtliche Röhren b gehen von einem in die Rauchkammer
eingebauten und gegen dieselbe luftdicht abgeschlossenen Kasten c (Fig. 8) aus, welcher durch
regelbare Oeffnungen mit der äuſseren Luft in Verbindung steht. Die auf diese Weise
zugeführte Luft soll in den Röhren b stark erhitzt
werden und dadurch eine möglichst vollständige Verbrennung der Heizgase
herbeiführen. Zur bequemen Reinigung der Heizröhren würde es nöthig sein, sämmtliche
Luftröhren schnell und ohne Mühe herausziehen zu können.
Um die Feuerung von dem stoſsweisen Ausblasen des Abdampfes unabhängig zu machen und
einen ruhigen gleichmäſsigen Zug zu erzeugen, will H. W. Norwood in Philadelphia (Erl. * D. R. P. Nr.
26334 vom 5. Juni 1883) frischen Dampf in folgender
Weise benutzen: Quer durch den luftdicht geschlossenen Aschenkasten ist ein mit
seitlichen Oeffnungen versehenes Rohr gelegt, an dessen eines Ende ein mit frischem
Dampf gespeister und Luft ansaugender Injector angeschlossen ist, während das andere
Ende in den Schornstein geführt ist. Die durch den Injector eingeblasene Luft
entweicht theilweise durch die mittels einer übergeschobenen Hülse mehr oder weniger
abschlieſsbaren Oeffnungen des Rohres in die Feuerbüchse, um hier zur Verbrennung zu
dienen; der Rest bläst in den Schornstein, verstärkt den Zug und verhindert das
Herausschlagen der Flamme beim Oeffnen der Feuerthür. Zur Regelung des Zuges sind in
der Rauchkammer vor den Rohrmündungen Klappen angebracht, welche vom Führerstande
aus eingestellt werden können. Der Abdampf der Cylinder wird in einem Rohre in dem
Schornsteine bis zu dessen Mündung hinaufgeführt. Ein Bedürfniſs für eine derartige
umständliche und viel Dampf verbrauchende Einrichtung scheint nicht vorhanden zu
sein.
Dasselbe gilt auch von Anordnungen, welche E. J. Mallet
in New-York (Erl. * D. R. P. Nr. 21994 vom 14. Juni 1882, I. Zusatz zu Nr. 20504,
vgl. 1883 249 * 151) zur Anwendung seiner Feuerung auf Locomotiven
in Vorschlag bringt. Die a. a. O. beschriebene Mallet'sche Feuerung ist gekennzeichnet durch die Benutzung eines Sauggebläses, Kühlung der abziehenden Heizgase, ehe sie
in dasselbe gelangen, Anwendung einer mit einzelnen Oeffnungen versehenen Mauer zum
hinteren Abschlusse des Feuerraumes und Zuführung von Luft hinter diese Mauer durch
einen Röhrenrost. Bei einer Locomotive soll nun nach dem Zusatzpatente das
Sauggebläse mitsammt einem kleinen Betriebsmaschinchen in der Rauchkammer
aufgestellt und die Kühlung der Heizgase durch Zerstäubung von Wasser vor der
Eintrittsöffnung bewirkt werden. Um den Abdampf, welcher auf diese Weise für die
Zugerzeugung überflüssig wird, zu verwerthen, ist eine besondere Einrichtung auf dem
Tender angebracht, in welcher der Abdampf die Verbrennungsluft und das Speisewasser
vorwärmt. Abgesehen davon, daſs stark erwärmtes Speisewasser die Benutzung von
Injectoren zur Kesselspeisung ausschlieſst, würde der etwa erzielte Gewinn in keinem
Verhältnisse zu den äuſserst umständlichen Vorrichtungen stehen.
J. Vilas in Paris (Erl. * D. R. P. Nr. 25 301 vom 13.
Juli 1883, II. Zusatz zu Nr. 20504) hat noch einige Aenderungen an dieser Mallet'schen Locomotivfeuerung angebracht, welche in
Fig. 15
Taf. 10 abgebildet sind, jedoch für feststehende Kessel
des Locomotivsystemes bestimmt zu sein scheinen. Der Röhrenrost ist durch einen
gewöhnlichen Rost ersetzt. Die Luftzuführung findet durch die hohle Wand F statt, welche den Feuerungsraum D von der (auch bei Mallet
vorhandenen) Verbrennungskammer L trennt. Die Wand F enthält eine ziemlich enge centrale Durchströmöffnung
f und einen Ringkanal N, in welchen die Luft unten bei M eintritt
und aus dem sie durch zahlreiche schräg nach der Kesselachse gerichtete Oeffnungen
o in den Raum L
gelangt. Eine gute Verbrennung mag hierbei zu erreichen sein; fraglich ist nur die
Dauer der Zwischenwand F. Ein Nachtheil ist ferner,
daſs die Länge des Kessels um die Länge der Verbrennungskammer vergröſsert wird,
wenn man an der Röhrenheizfläche nichts einbüſsen will. Zur Kühlung der Heizgase vor
dem Eintritte in das Sauggebläse H ist hier hinter dem
eigentlichen Kessel noch ein kurzer, gleichfalls von Röhren durchzogener
Vorwärmkessel J angebracht, aus welchem das vorgewärmte
Wasser durch ein um den Hauptkessel herum geführtes Rohr P in diesen eingeleitet ward.
Tafeln