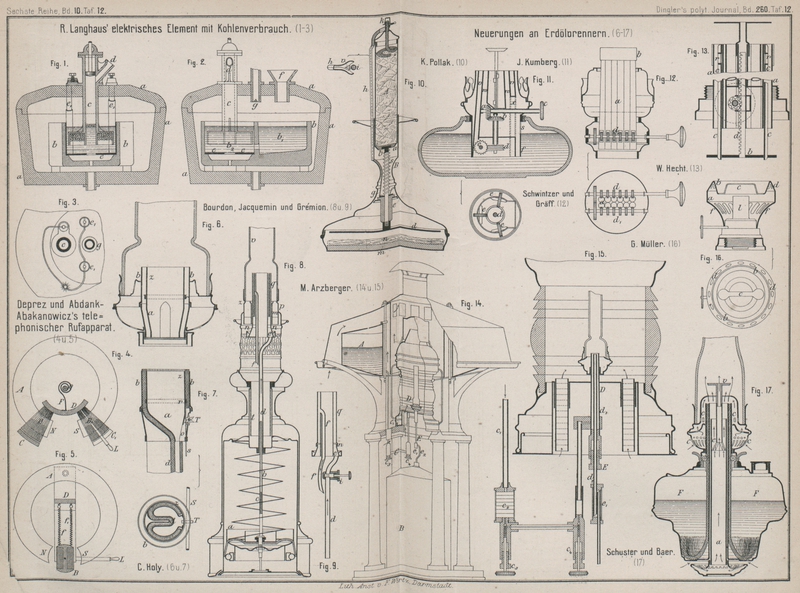| Titel: | Ueber Neuerungen an Erdölbrennern. |
| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 175 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen an Erdölbrennern.
(Patentklasse 4. Fortsetzung des Berichtes Bd. 257
S. 509.)
Mit Abbildungen auf Tafel
12.
Ueber Neuerungen an Erdölbrennern.
K.
Pollak in Sanok, Galizien (* D. R. P. Nr. 33211 vom 24. März 1885) schlägt vor, eine Benzinkerze mit elektrischer Anzündevorrichtung zu
versehen. Die im Leuchter B auf- und abschiebbare Kerze
A (Fig. 10 Taf. 12) trägt im
Boden a aus Ebonit einen Metallstift b, welcher im isolirenden Lager e geführt wird und unten eine Zinkplatte d
trägt. Von der Platte f führt ein isolirter
Leitungsdraht g durch das oben gegabelte Rohr h zum Brenner i. Von dem
auf dem einen Arme der Gabel befestigten isolirten Drahte g führt eine Platinspirale v nach dem anderen
Gabelarme. Auf dem Boden des Leuchters ist eine Kohlenplatte m befestigt, auf welche eine Schicht n von
schwefelsaurem Quecksilberoxyd aufgelegt ist; letzteres wird mit Wasser und Glycerin
gehörig angefeuchtet und behufs Zusammenhaltens mit einem Leinwandlappen
bedeckt.
Beim Herabdrücken der Kerze A kommt die Zinkplatte d mit dem schwefelsauren Quecksilber n in Berührung. Es entsteht ein elektrischer Strom,
welcher von der Zinkplatte d durch Stift b, Platte f, Draht g, Platinspirale v, Rohr
h, Leuchter B zur
Kohle m geht und die Platinspirale zum Glühen bringt.
Andererseits hat sich beim Herabdrücken der Kerze A die
Kappe k durch Anstoſsen an das feststehende Rohr h aufgeklappt, so daſs die Zündung erfolgt.
Nachdem die Kerze entzündet ist, läſst man dieselbe los, so daſs sie unter der
Wirkung der Feder s selbstthätig nach oben in die
gezeichnete Stellung zurückgeht.
W. H.
Hecht in Berlin (* D. R. P. Nr. 32423 vom 7. Januar
1885) will die Dochtführungsröhren für
Mitrailleusenbrenner mit mehreren unter ihren Mündungen angebrachten Haken
versehen, um das Abschmelzen derselben zu verhüten. Die Platte b (Fig. 13 Taf. 12) wird
mittels Zahnstange d und Getriebe auf- und abbewegt,
wodurch die Dochtführungen c, welche einerseits an
genannter Platte b befestigt, andererseits aber in den
Dochthülsen a geführt sind, gezwungen werden, an dieser
Bewegung theilzunehmen. Die Dochtführung c besteht für
jeden einzelnen Docht aus einem in der Längsrichtung durchschnittenen Rohre, welches
am unteren Ende in der Platte b verlöthet, während das
obere Ende derselben einfach glatt abgerundet ist. Die Haken r zum Festhalten des Dochtes werden mit den Dochtführungen aus einem
Stücke hergestellt, indem man dieselben spitz ausstanzt und die so hergestellten Lappen nach innen
rechtwinklig umbiegt.
Bei dem Mitrailleusenbrenner von Schwintzer und
Gräff in Berlin (* D. R. P. Nr. 33180 vom 5. Februar
1885) treten die in einem Kreise in dem Ringe b (Fig.
12 Taf. 12) ausmündenden Dochthülsen a unten
zu zwei neben einander liegenden Reihen zusammen, deren Dochte durch eine gleiche
Anzahl im Eingriffe stehender Triebe d und d1 gleichzeitig ohne
Anwendung eines Dochtschlittens auf- oder niedergeschraubt werden können.
Bei dem von J. A. Kumberg in St.
Petersburg (* D. R. P. Nr. 28413 vom 5. Februar
1884) für schweres russisches Erdöl
bestimmten Rundbrenner ragt das Rohr f (Fig. 11 Taf. 12) in das
Oel hinein. Die im Oelbehälter entwickelten Gase entweichen durch eine seitliche
Oeffnung s und den ringförmigen Kanal w zur Flamme. Die beiden Dochtrohre v sind in bekannter Weise durch einen Steg verbunden,
welcher zugleich die Umhüllung der Oeffnung x für den
Eintritt der Luft zur inneren Dochthülse bildet. Beim Drehen des Schlüssels c wird durch Vermittelung der Kegelräder a und b die Schnecke d gedreht, welche ihrerseits die 3 Rädchen e in Bewegung setzt, wodurch der Docht vollkommen
gleichmäſsig auf- und abgeschoben wird. (Vgl. 1883 250
409.)
Georg
Müller in Berlin (* D. R. P. Nr. 33893 vom 27. Februar
1885) hat bei Brennern für Sturmlaternen und
sonstige Lampen ohne Cylinder, um das plötzliche Verlöschen der Flamme bei
Windstöſsen u. dgl. zu verhindern, den Brennerkopf a
(Fig. 16
Taf. 12) so eingerichtet, daſs derselbe mittels eines äuſseren Randes b den Brennerschlitz c
umgibt und etwas über denselben hervorragt. An dem äuſseren Umfange befinden sich
Luftzuführungslöcher d und es sind gleichzeitig an dem
sich verengenden Theile des Brennerkopfes unterhalb des Brenners l und des Brennerschlitzes c eine zweite Reihe von Luftzuführungsöffnungen f angebracht.
Wird nun die Flamme bei eintretenden heftigen Erschütterungen oder Windstöſsen in den
Brennerkopf hineingedrückt, so findet sie durch die Erweiterung desselben Raum, sich
auszudehnen, und gleichzeitig durch die oberen Oeffnungen d einen Ausweg, aus welchem sie herauszuschlagen vermag, während
gleichzeitig ein das Weiterbrennen bedingender Luftzutritt zur Flamme durch die
Oeffnungen f stattfinden kann.
C.
Holy in Berlin (* D. R. P. Nr. 34739 vom 1. September
1885) empfiehlt an flachdochtigen Rundbrennern eine wellenförmige Dochtführung
am unteren Ende der Dochthülse, welche nach oben hin allmählich in den
Cylindermantel übergeht. Die Wände der Dochthülse a
(Fig. 6
und 7 Taf. 12)
sind am unteren Ende so gestaltet, daſs der flache Docht an einer oder mehreren
Stellen wellenförmige Führung erhält, somit auf einem möglichst kleinen Durchmesser
eine groſse Saugfläche des Dochtes erreicht wird. Diese wellenförmige Führung läuft
nach oben hin allmählich
in den cylindrischen Theil über und bringt den Docht d
in die erweiterte Rundform des Cylindermantels z. Der
Umfang der wellenförmigen Führung muſs so bemessen sein, daſs derselbe gleich ist
dem Umfange des Cylindermantels z. Ein mit Greifzähnen
versehener Ring r trägt die gelochte Stange s (Fig. 7) und schiebt sich
dicht auf den Cylindermantel z der inneren Dochthülse
a. In die Löcher der Stange s greifen die Zähne des am Schlüssel S
befestigten Triebes T, so daſs beim Drehen desselben
nach rechts oder links der Ring r und mit diesem der
Docht d auf- oder niedergeschraubt werden kann.
Nachdem der äuſsere cylindrische Theil b abgeschraubt
ist, wird der Docht d in den unteren, kegelförmig und
wellenförmig gestalteten Theil eingeführt und über dem zurückgeschraubten Ringe r fest zusammengelegt, so daſs die Kanten des Dochtes
an einander liegen. Hierauf wird der äuſsere Theil b
übergeschraubt und der Docht d mittels Triebes T aufwärts geschoben. Die Luft wird durch eine
Durchbrechung o nach dem Inneren des Brenners
geleitet.
W. E. A.
Hartmann in Swansea,
England (* D. R. P. Nr. 34284 vom 5. April
1885) will für Erdöllampen, welche den
Oelbehälter im Fuſse enthalten, eine Ueberlaufröhre anwenden, die verhindert, daſs
beim Umwerfen der Lampe das Oel ausflieſst. Zu diesem Zwecke wird das Ueberlaufrohr
mit einem eingelötheten schraubenförmigen Drahte versehen, dessen Windungen das
ausflieſsende Oel folgen muſs, so daſs bei wagerechter oder geneigter Lage des
Rohres oder der Lampe ein hydraulischer Verschluſs entsteht, welcher das Auslaufen
des Oeles verhindert.
Bei der Moderateurlampe von Bourdon, Jacquemin und
Grémion in Paris (* D. R. P. Nr. 34725 vom 24. Mai
1885) steigt das von dem Kolben a (Fig. 8 und 9 Taf. 12)
gedrückte Erdöl durch das Mittelrohr b, welches die
Regulirstange c enthält und sich im festen Rohre d nach oben schieben kann, in den Ringraum e des Brenners. Hier füllt das Erdöle anstatt wie bei
Oel bis zum Brennerrande zu reichen, nur einen Theil des Raumes e aus, da es durch das im Inneren des Brenners angebrachte Rohr f, welches etwa 5cm unter der Flamme
ausmündet, in den Oelbehälter zurückflieſst. Die Rohre d und f sind von einem Metallsiebe t umgeben. Der Oelzufluſs wird durch die Stange c sowie durch den Hahn i
(vgl. Fig. 9)
geregelt. Der innere Ring m des Cylinderträgers ruht
auf einem Absatze n des äuſseren Brandrohres q und sichert dadurch das richtige Einstellen des
Cylinderträgers p, der mit einer Einschnürung z versehen ist, auf welcher der Cylinder v ruht. Das äuſsere Brandrohr q besteht aus zwei Theilen, welche durch Zinnlöthung mit einander
verbunden sind. Diese Einrichtung gestattet im Falle einer Ausbesserung ein leichtes
und bequemes Auseinandernehmen des Brenners.
M.
Arzberger in Wien (* D. R. P. Nr. 33891 vom 14. November
1884) verwendet für Lampen mit langer
Brenndauer zwei etwa gleich groſse Oelbehälter A und B (Fig. 14 und 15 Taf. 12),
welche durch eine Rohrleitung
CE mit eingeschaltetem Brenner D verbunden sind. Der Brenner besteht aus einem Zufluſsrohre d1 und einem in
demselben derart angeordneten Abfluſsrohre d2, daſs dessen obere Mündung etwas unter der des
äuſseren Rohres steht und zwischen diesen beiden Rohrmündungen der Ueberfall des
Oeles zum unteren Behälter hin stattfindet. Zugleich ist mittels dieser Anordnung
die Brennstelle gebildet und besitzt daselbst das Oel eine ringförmige,
gewissermaſsen in steter Bewegung sich befindende Oberfläche, wodurch und durch die
Erwärmung seitens der Flamme die leichteren, flüchtigeren Bestandtheile desselben
zur Verbrennung gelangen, wohingegen die schwereren sammt den darin enthaltenen
Unreinigkeiten oder unverbrennbaren Bestandtheilen in das Rohr d2 überfallen und sich
nicht an dem Brenner, also an den Mündungen der Rohre d1 und d2 festsetzen können. Damit ein stetiger
Abfluſs dieser Oelbestandtheile stattfindet, kann die Mündung des Rohres d2 mit einem oder
mehreren Ausschnitten oder Einkerbungen versehen sein.
Die Zuleitung c1 enthält
ein Filter c2, welches
aus mehreren Lagen Filtrirpapier bestehen kann, und ein oder zwei Nadelventile c3 und c4 zur Abhaltung der
gröberen Unreinigkeiten und zur Regulirung des Oelzuflusses. Das Abfluſsrohr E ist bei e1 getheilt und mit einem Behälter umschlossen, um
den Zutritt von Luft von unten und zum Inneren des Rohres d2 hydraulisch abzuschlieſsen. Bei e2 ist ein Glasrohr
angebracht, durch welches das vom Brenner abflieſsende Oel sichtbar wird. Je nach
dessen Menge wird der Oelzufluſs mittels der Ventile c3 und c4 geregelt.
Wenn eine Lampe beispielsweise auf 6 Wochen gerichtet ist, so wird nach Ablauf von 4
oder 5 Wochen der obere Behälter A wieder voll gefüllt,
der untere B entleert und der Brenner D gereinigt. Da diese Lampe in besagter Frist bei jeder
Witterung und Temperatur ohne Bedienung fortbrennt, so ist sie besonders geeignet,
als Seeleuchte an schwer zugänglichen Stellen
angebracht zu werden, wo der beständige Aufenthalt eines Wärters unmöglich oder
unbequem oder zu kostspielig sein würde.
Die Firma Schuster und Baer in Berlin bringt
neuerdingsVgl. 1877 224 * 552. 1879 233 * 371. 234 * 292. 1880 236 * 298. 1881 240 *
290. 1883 248 * 378. 1884 252 * 31. sogen. Patent-Reichslampen in den Handel, welche alle anderen Lampen thatsächlich
in den Schatten stellen, da die gröſste Sorte, sogen. 40linige, 100 bis 110 Kerzen
gibt.
Die Lampe zeichnet sich, wie in Fig. 17 Taf. 12
veranschaulicht ist, dadurch aus, daſs das Luftzuführungsrohr a mitten durch den Oelbehälter F geht. Die Luft wird dann durch den sternartig gestalteten Einsatz e und die Brennscheibe v
passend vertheilt. Ein anderer Theil der Verbrennungsluft tritt in bekannter Weise
durch den Mantel c zur Flamme.
Wie sich Referent durch Versuche überzeugt hat, eignet sich diese neue Lampe sowohl
für amerikanisches Erdöl, wie auch für russisches sogen. Kerosin. 100, Stundenkerzen
kosten nur 4 Pf., so daſs diese Lampe z. Z. als billigste Lichtquelle bezeichnet
werden muſs (vgl. F. Fischer 1883 248 376).
Tafeln