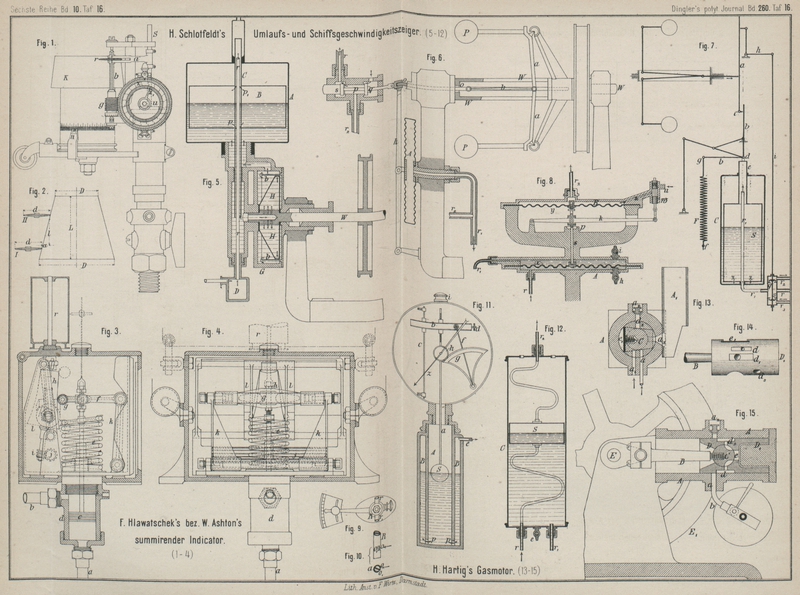| Titel: | Neuere summirende Indicatoren. |
| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 241 |
| Download: | XML |
Neuere summirende Indicatoren.
Mit Abbildungen auf Tafel
16.
Neuere summirende Indicatoren.
Das mit einem gewöhnlichen Indicator erhaltene Diagramm gewährt wohl ein
übersichtliches Bild der Dampfvertheilung und der während eines Kolbenhubes im
Cylinder sich verändernden Dampfspannung; dasselbe läſst auch die Bestimmung der
Leistung des Dampfes im Cylinder durch Flächenberechnung des Diagrammes zu, jedoch
in nicht genügender Weise. Dieses Rechnungsergebniſs gilt bloſs für den einen
Kolbenhub, für welchen die Aufnahme des Diagrammes erfolgte, und kann nur auf eine
längere Arbeitzeit Geltung erhalten, wenn sowohl in den zu überwindenden
Widerständen, als in den Spannungs- und Füllungsverhältnissen keine Schwankungen
vorkommen. Die Widerstände wechseln jedoch bei den meisten Dampfmaschinen und es
fallen demnach durch die Regulatorthätigkeit die indicirten Leistungen jedes
Kolbenhubes verschieden aus. Um darum einen einigermaſsen sicheren Schluſs auf die
vom Dampfe in dem Cylinder geleistete Arbeit aus dem Indicatordiagramme zu ziehen,
ist es nothwendig, eine groſse Zahl derselben aufzunehmen und zu berechnen. Es sind
nun an Indicatoren verschiedene Einrichtungen angegeben worden, mittels welchen ohne
Unterbrechung eine Anzahl Diagramme fortlaufend aufzuzeichnen sindVgl. Mallet 1876 221
282. Guinotte 1877 226 550. Schäffer und Budenberg 1879
234 * 15. Schöpfleuthner 1880 236 * 6. C. Strube 1881 240 *
338.; jedoch ist die Berechnung der letzteren, selbst mit Hilfe
eines Planimeters, zu umständlich, um für den Zweck genauerer Angabe der indicirten
Leistung geeignet zu sein. Hieraus kann ein Bedürfniſs nach Indicatoren, welche
selbstthätig auf eine längere Dauer die vom Dampfe im Cylinder geleistete Arbeit
zusammenzählen, sogen. summirenden Indicatoren, gefolgert werden. Solche Apparate,
welche bereits seit längerer Zeit bekannt sind (vgl. Ashton 1869 194 * 16), besitzen ein Zählwerk,
aus dessen Angabe die indicirte Leistung und dadurch die mittlere Arbeitspannung des
Dampfes leicht zu berechnen ist. Im Nachfolgenden sind zwei neuere Ausführungen
solcher summirender Indicatoren beschrieben.
Prof. F. Hlawatschek in Graz läſst den Indicator
gewissermaſsen als Planimeter wirken, so daſs, indem
der sonst das Diagramm zeichnende Stift zu einem Meſsrädchen gemacht wird, durch
entsprechendes Abrollen desselben auf der Zeichenfläche des Indicators die
jedesmaligen Diagrammflächen nach einander summirt werden. Die Einrichtung ist dabei
so getroffen, daſs jeder gewöhnliche Indicator leicht in
einen „summirenden“ verwandelt werden kann. An Stelle des
schwingenden Zeichencylinders wird, wie aus Fig. 1 Taf. 16 zu
entnehmen ist, ein abgestutzter Kegel K benutzt, an
welchem das Meſsrädchen r durch eine Feder in
beständiger Berührung gehalten wird. Das Meſsrädchen ist mit Keil und Nuth auf der Achse b verschiebbar und wird zwischen dem gegabelten Arme
a gehalten, welcher mit der Indicatorstange S verbunden ist, so daſs das Rädchen r die Auf- und Abbewegungen des Indicatorkolbens
mitmacht. Die Achse b trägt eine Schnecke g, welche in zwei an einander liegende, auf demselben
Zapfen sitzende Räder u mit 100 bezieh. 101 Zähnen
greift. Der Zeiger z gibt somit die Zahl der
Umdrehungen des Meſsrädchens bis zu 100, ein zweiter Zeiger z1 aus den Verdrehungen der beiden Räder
u gegen einander die Zahl der Hunderte der
Umdrehungen bis zu 10000 an. Der Schwingungswinkel des auf gewöhnliche Weise mittels
Schnur bewegten Kegelstutzes K kann an einem Nonius n genau abgelesen werden.
Für jede Hin- und Herschwingung des Kegelstutzes K läſst
sich nun ein mittlerer gleich bleibender Stand des Meſsrädchens denken, der einer
mittleren Dampfspannung p entspricht und bei welchem
die gleiche Umdrehungszahl des Meſsrädchens auf dem mittleren Durchmesser des
Kegelstutzes besteht, wie sie sonst durch die wechselnden Durchmesser hervorgebracht
wird. Bezeichnen nach Fig. 2 Taf. 16 d den Durchmesser des Meſsrädchens, n und n1 die Umdrehungszahlen der Hin- und der
Herschwingung des Kegelstutzes, l die 1k/qc Dampfdruck
entsprechende Hubhöhe des Meſsrädchens, so findet sich der Unterschied a der Radien für die Hubhöhe l aus der Proportion α : l = ½ (D1
– D) : L, nämlich α = (D1 – D)l : 2L. Ist die gesammte
Umdrehungszahl des Meſsrädchens bei der Hin- und Herschwingung u = n – n1 und der
Schwingungswinkel des Kegelstutzes φ (auf den
Halbmesser 1 bezogen = φ°) so ist: uπd = φαp und, da der
Bogen:
\varphi=\varphi^0\,\frac{2\,\pi}{360},\ \mbox{so folgt}\
p=\frac{d\,360}{2\,\varphi^0\,\alpha}\,u=\frac{360\,d\,L\,u}{\varphi^0\,(D_1-D)\,l}
Bei der Dampfspannung p ist bei
einer Kolbenfläche F und einem Hube s die Arbeit A = pFs und
die Leistung während einer länger andauernden Zeit von T Secunden, während welcher das Meſsrädchen U
Umdrehungen gemacht hat: E = 2pFsU und mit Berücksichtigung des obigen Werthes von p die Anzahl der Pferd:
N=\frac{2\,\times\,360\,d\,L}{75\,(D_1-D)}\ \frac{1}{l}\
\frac{1}{\varphi^0}\ \frac{U\,F\,s}{T},
oder da das erste Glied bei einem und demselben Apparate immer
gleich bleibt:
N=C\,\frac{1}{l}\ \frac{1}{\varphi^0}\
\frac{U\,F\,s}{T}.
Bei diesem Indicator tritt ein schädlicher Widerstand durch die Reibung des
Meſsrädchens beim Auf- und Abschleifen desselben an dem Kegelstutzen auf; doch wird
demselben in Berücksichtigung, daſs bei jedem Planimeter ein Gleiches der Fall ist
und beim gewöhnlichen Indicator der durch eine Hebel Verbindung wirkende
Schreibstift eine sichtbare Spur hinterlassen muſs, keine wesentliche Bedeutung
beigelegt. Ein von E. Kraft und Sohn in Wien
hergestellter summirender Indicator von Hlawatschek ergab bei
einem Versuche 29,2, ein gewöhnlicher Indicator unter denselben Umständen 29,1
Pferd.
Durchgebildeter erscheint der summirende Indicator von Will.
Ashton in Manchester (vgl. * D. R. P. Kl. 42 Nr. 32683 vom 18. Oktober
1884), welcher von E. Scott und Comp. in
Newcastle-on-Tyne ausgeführt wird und auf der Erfindungsausstellung in London 1885
in Benutzung zu sehen war. Bei diesem Apparate sind die schädlichen Widerstände
ziemlich vermieden und derselbe liefert auch das Ergebniſs für beide Cylinderseiten zusammen, nicht wie der vorher beschriebene
Indicator nur für eine Seite; es werden somit bei der stetigen Summirung auch
etwaige Verschiedenheiten der beiden Cylinderseiten in Betracht gezogen. Weiter
lassen sich ebenfalls beim neuen Ashton'schen Indicator
gewöhnliche Diagramme abnehmen. Die den Apparat veranschaulichenden Fig. 3 und 4 Taf. 16 sind abweichend
von der in der Patentschrift gegebenen nach einer Ausführung gezeichnet. Mit den
beiden Cylinderseiten der Dampfmaschine werden durch die Rohre a und b die beiden Seiten
des Indicatorcylinders d verbunden (vgl. Hambruch 1882 246 * 212), in
welchem der Kolben c durch eine auſserhalb liegende,
mit seiner Stange verbundene Feder e in der
Mittelstellung zu erhalten gesucht wird. Die Indicatorkolbenstange ist in gelenkiger
Verbindung mit einem Rahmen f, welcher in einem zweiten
drehbaren Rahmen k gelagert ist. In dem Rahmen f liegt vorn eine Walze g,
welche durch die Wirkung einer hinter k liegenden Feder
in beständiger Berührung mit einem hyperbolischen Kegel h erhalten wird. Der Kegel h lagert in einem
Rahmen l, welcher durch Schnüre in bekannter Weise mit
dem Kreuzkopfe der Dampfmaschine verbunden und folglich von demselben aus hin- und
hergeschoben wird. Der Kegel h trägt auf seiner Achse
eine Schnecke i, welche bei der Hin- und Herbewegung in
den Zähnen einer gezahnten Achse j schleift, so daſs
die durch Abrollen des Kegels h an der Rolle g erfolgenden Drehungen desselben auf die Achse j übertragen werden; letztere setzt dann ein Zählwerk
in Bewegung. Ein zweites im Apparate angebrachtes Zählwerk gibt die Zahl der
Doppelhübe der Dampfmaschine an. Mit der Stange des Indicatorkolbens c kann noch ein Schreibstift verbunden werden, welcher
auf dem (an einem den ganzen Mechanismus einhüllenden Gehäuse zu befestigenden)
Cylinder r gewöhnliche Diagramme abzunehmen gestattet.
Die Umfangsflächen der Rolle g und des Kegels h sind mit feinen, spitzen, in einander tretenden
Zähnchen versehen, so daſs Gleitungsverluste, welche die Richtigkeit der Angabe des
Zählwerkes beeinträchtigen, kaum vorkommen können.
Der Kegel h hat darum eine hyperbolische Form erhalten,
weil bei derselben eine der Schwingung der Rolle g mehr
entsprechende Bogenform der Abwickelungslinie erreicht wird. Nach der
Asymptotengleichung der Hyperbel y = b : (a + x), wo also y als der
jeweilige Radius der Berührungsstelle der Rolle g
anzusehen und x abhängig von den Erhebungen und Senkungen der
letzteren ist, hat man die Anzahl Umdrehungen n des
Kegels h bei einer wagerechten Verschiebung l desselben n = l : 2πy = l (a + x) : 2πb. Folglich ist
hierbei n direkt proportional den Bewegungen des
Indicatorkolbens.
Bezeichnet wieder n1 die
Umdrehungszahl des Kegels während des Rückganges, so ist die gesammte Umdrehungszahl
u während eines Doppelhubes:
u=n-n_1=\frac{l}{2\,\pi\,b}\,(x-x_1)=\frac{l}{2\,\pi\,b}\,z,
wo z die einem mittleren Stande
des Indicatorkolbens entsprechende Höhe der Stellung der Rolle g bedeutet. Die Gröſse der Verstellung der Rolle g und somit u wird nun bei
einem gegebenen Dampfdrucke abhängig von der Stärke der Feder e. Je gröſser f : p, wo p die Dampfspannung,
f die Federspannung bedeuten, desto geringer wird
die Umdrehungszahl u sein. Ebenso wird auch u gröſser, je bedeutender die Verschiebung l ist. Man erhält also in gleicher Weise wie oben die
Anzahl Pferd in einer Zeit von T Secunden, wenn F wieder die Kolbenfläche und s den Hub bezeichnen:
N=C\,\frac{1}{l}\ \frac{f}{p}\
\frac{U\,F\,s}{T},
wo wieder C als für ein und
denselben Apparat, gleichbleibend aus den Gröſsen des hyperbolischen Kegels, ähnlich
wie beim vorherigen Apparate, mit Hilfe der Hyperbelgleichung zu bestimmen ist.
Tafeln