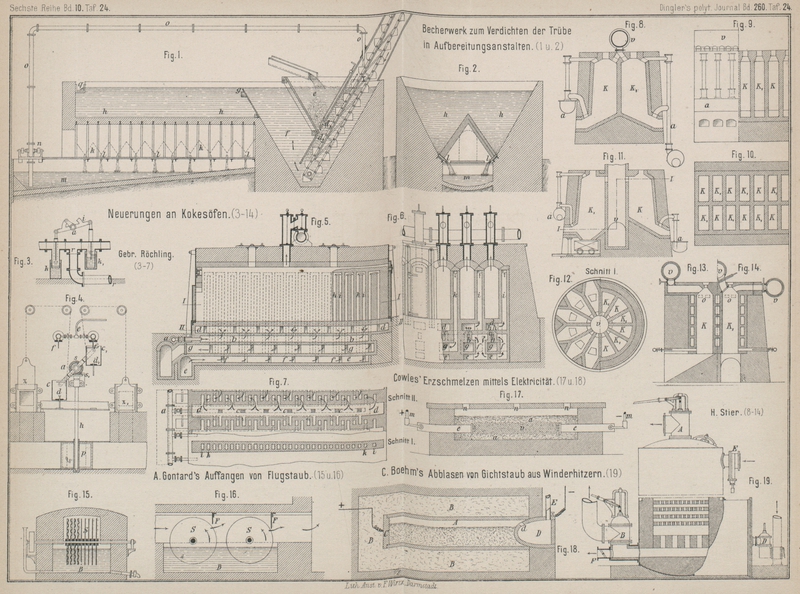| Titel: | Ueber Neuerungen an Kokesöfen. |
| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 376 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen an Kokesöfen.
(Patentklasse 10. Fortsetzung des Berichtes Bd.
259 S. 550.)
Mit Abbildungen auf Tafel
24.
Ueber Neuerungen an Kokesöfen.
Die Gewinnung von Destillationsproducten, Heizgasen und Kokes
aus minderwerthigen Brennstoffen soll nach H. Stier
in Zwickau (* D.
R. P. Nr. 35120 vom 17. Mai 1885) dadurch geschehen, daſs abwechselnd in
der einen Kammer eines Kokesofens eine Vergasung durch
Heizgaserzeugung oder vollständige Verbrennung, in der anderen Kammer eine Entgasung durch die von der ersten Kammer gelieferte
Hitze stattfindet.
Zu diesem Zwecke stehen die Kammern K (Fig. 8 bis 10 Taf. 24) in Vergasung,
wenn in den Kammern K1
entgast wird, und umgekehrt; ganz ebenso verhält es sich bei Anwendung der bekannten
Kokesöfen, welche in der Grundform wie in Fig. 10 an einander
gereiht sind und nur den Unterschied aufweisen, daſs bei der neuen Anordnung die
einzelnen Kammern K, K1
nur je durch eine Scheidewand getrennt, bei den gewöhnlichen Kokesöfen aber Heizzüge
zwischen den einzelnen Kammern eingelagert sind. – Fig. 11 und 12 Taf. 24
zeigen eine andere Anordnung dieser neuen Oefen.
Die bei der Vergasung, z.B. in den mit K bezieh. K1 bezeichneten
Kammern, entstehenden Vergasungsproducte gelangen bei Kokesöfen gewöhnlicher
Anordnung (vgl. Fig. 13 und 14 Taf. 24) durch
Oeffnungen o in die Heizzüge, den Inhalt der
benachbarten Kammern K1
bezieh. K entgasend, während das letztere bei den neuen
Oefen (Fig. 8
bis 12)
mittels der durch die die Kammern K, K1 trennenden Scheidewände aus dem jeweiligen
Vergasungsraume abflieſsenden Wärme bewirkt wird. Die Vergasungsproducte werden
entweder auf demselben Wege, welchen in gewöhnlichem Betriebe bei Kokesöfen die
Verbrennungsgase nehmen, abgezogen, oder es sind für diesen Zweck besondere
Vorrichtungen v mit den Kammern verbunden. Die
Entgasungsproducte werden entweder mit den Vergasungsproducten zusammen, oder durch
besondere Vorrichtungen a abgeführt.
Reicht die Dauer der z.B. in den Kammern K bezieh. K1 betriebenen
Vergasung bezieh. die Wärme ihrer Producte hin, um mehrere Füllungen in K oder K1 zu entgasen, was besonders bei Kohlen der Fall
ist, so kann man die erst entgasten Füllungen entnehmen, frische einsetzen und damit
fortfahren, bis für die Umstellung der Betriebsweise der Kammern zu einander und
nachfolgenden Vergasung in K oder K1 eine letzt entgaste Füllung
verbleibt, worauf wieder umgekehrt verfahren wird u.s.w.
Zur Zuführung der Verbrennungsluft haben Gebrüder
Röchling in Saarbrücken (* D. R. P. Nr. 35001 vom 17.
Januar 1885) die in Fig. 5 bis 7 Taf. 24 veranschaulichte
Einrichtung getroffen. Die Gase treten durch das Rohr a
in den Kanal b und aus diesem durch die Spalten c in den Sohlkanal d. Die
Luft tritt durch den Kanal e in die Kanäle f, umspült den Abhitzekanal g und steigt durch die Spalten h in den
Sohlkanal d, wo sie hoch erhitzt mit dem Gase
zusammentrifft und die Verbrennung desselben bewirkt. Die brennenden Gase steigen
durch die Züge i aufwärts, durch die Züge k abwärts in den Abhitzekanal g und von da nach dem gemeinschaftlichen Kamine. Der Zutritt von Gas und
Luft wird durch auf die Spalten c und h gelegte verschiebbare Steinplatten geregelt.
Zum selbstthätigen Wenden des Zuges benutzen Gebrüder Röchling (* D. R. P. Nr. 33956 vom 17. Januar
1885) zwei in gleichen Zeitabschnitten sich füllende und entleerende Gefäſse. Wie
aus Fig. 4
Taf. 24 zu entnehmen ist, sitzt auf der wagerechten Achse a ein gleicharmiger Hebel, an dessen Enden die beiden Gefäſse c und c1 aufgehängt sind; jedes der Gefäſse hat am Boden
ein Ventil d bezieh. d1. Ueber den Gefäſsen c
und c1 sind von dem
Wasserzufluſsrohre e zwei mit Ventilen f und f1 versehene Gehäuse angeordnet. Die Achse a trägt ein Kegelrad s,
welches in ein gleich groſses Kegelrad s1 auf der Achse h der
im Zuge drehbaren Klappe p greift. Am hinteren Ende der
Achse a sitzt noch lose der Hebel i (Fig. 3 Taf. 24), der durch
einen Anschlag auf a bewegt wird und ebenfalls zwei
Gefäſse k und k1 trägt, in welche Stutzen des Gasrohres r hineinragen. Diese Stutzen sind durch eine mittlere
Wand zum Zwecke des wechselweisen Gasdurchlasses getheilt, indem bei gesenktem
Gefäſse k und k1 das Gas auf der entsprechenden Seite aus dem Rohre
r entweichen kann, während es sonst durch den
gebildeten Wasserverschluſs abgesperrt ist.
Wird also die Klappe p gedreht, so kommt eines der
Gefäſse c oder c1 nach oben; dasselbe stöſst das Ventil f auf, füllt sich und senkt sich wieder, wenn das
Gewicht des eingelaufenen Wassers groſs genug geworden ist. Dabei wird der Zug durch
die Klappe p umgestellt und gleichzeitig durch das
entsprechende Gefäſs k oder k1 der Gasstrom. Unten angekommen, kann
das Wasser aus dem Gefäſse c bezieh. c1 durch Aufstoſsen des
Bodenventiles d bezieh. d1 wieder auslaufen.
Die Schieber z und z1 welche durch die Verdrehung der Achse a ebenfalls umgestellt werden, dienen zum abwechselnden
Oeffnen und Schlieſsen der beiden Luftzutrittkanäle.
Tafeln