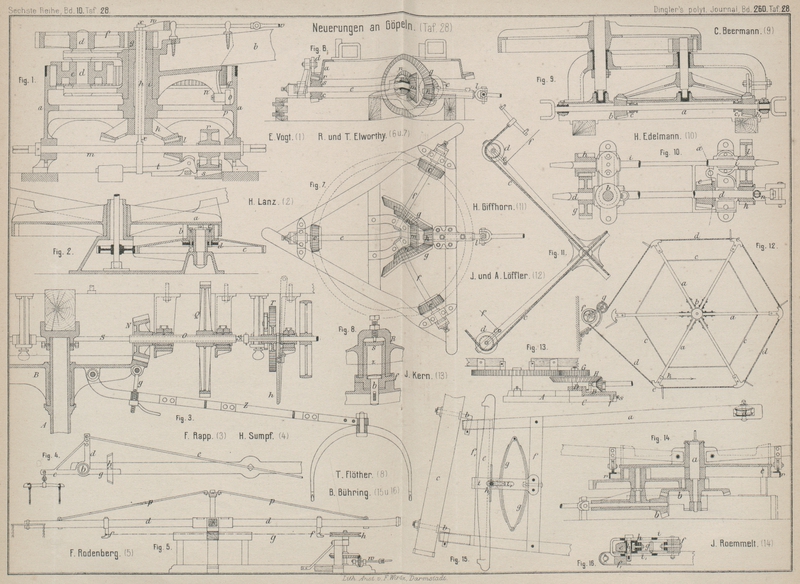| Titel: | Ueber Neuerungen an Göpeln (Rosswerken). |
| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 446 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen an Göpeln
(Roſswerken).
Patentklasse 45 und 46. Mit Abbildungen auf Tafel 28.
Ueber Neuerungen an Göpeln.
Von den beiden verschiedenen Klassen der Göpel, den Zuggöpeln und Tretgöpeln, hat
sich nur die erstere in Deutschland eingebürgert, während die Tretgöpel trotz ihrer
vielfachen Vorzüge – sie nehmen ungleich weniger Raum ein als die Zuggöpel und
gestatten eine erhebliche Ausnutzung des arbeitenden Thieres, da dieses ohne Wendung
zu fortwährender Arbeit in gleichbleibender Richtung gezwungen wird – nur in
Nordamerika eine einigermaſsen groſse Verbreitung haben sollen. Von den Zuggöpeln
werden wiederum die leicht fortschaffbaren und mit geringen Umständen überall
aufstellbaren liegenden Ausführungen den stehenden
Anordnungen, den sogen. Gebäudegöpeln, vorgezogen.
Letztere finden ausschlieſslich wohl dort Verwendung, wo ein genügender gedeckter
Raum zur ständigen Verfügung für den Göpel steht.
Von den liegenden Zuggöpeln haben sich die mit
Zahnradübersetzung am meisten verbreitet, während die Seil- und Kettengöpel, bei
denen das Zahnradgetriebe durch ein Seil-, Ketten- oder Riementriebwerk ersetzt
wird, sowie die Schraubengöpel, bei welchen ein von den Zugthieren umgetriebenes
liegendes Schraubenrad auf eine auf die Betriebswelle aufgesteckte Schraube
einwirkt, in wesentlich geringerer Anwendung stehen.
Liegende Zuggöpel.Vgl. W. Bergner 1876 221 * 14. J. Hallstroem 1880 238 352. Der in Fig. 1 Taf. 28
dargestellte Göpel von E. Vogt in
Ottmachau (* D. R. P. Nr. 31135 vom
10. Oktober 1884) besitzt Einrichtungen zur Verhinderung des Abbrechens der Zugbaumhülse und zur schnellen Bremsung der Antriebswelle. Der das Gestell bildende
Schutzcylinder a ist mit innerer Verzahnung versehen,
an welcher das mit dem Zugbaumarme b verbundene, um den
Bolzen d drehbare Zahnrad e abrollt, um seine Bewegung mittels des Rades f auf das Triebrad g der Hauptachse h zu übertragen. Letztere ist in dem cylindrischen
Mittelstücke i des Gestelles a gelagert und treibt mittels seines Kegelrades k das entsprechende Kegelrad l der nach
beiden Seiten des Gestelles a heraustretenden Welle in. Der Zugbaumhalter läuft zum Schütze gegen das
Abbrechen mit der an seinem Stützarme n vorgesehenen
Rolle o auf dem inneren vorspringenden Rande p des Gestelles; ein zweiter Rand q verhindert auch das Abheben des Zugbaumhalters.
Zur möglichst schnellen Bremsung des Triebwerkes sitzt auf der Betriebswelle m ein Bremsrad r, gegen
dessen Umfang der Bremsbacken s durch den Hebel t gedrückt werden kann. Diese Bremse wird vom Führer
der Zugthiere aus durch Verschiebung der Zugstange v
bethätigt, deren Keil w dann unter den Kopf der in der
hohlen Achse h geführten Stange x hervorgezogen wird und dadurch den niederfallenden Gewichtshebel t zwingt, die Bremse anzuziehen, d.h. den Keil s gegen das Bremsrad zu drücken. Die Lüftung der Bremse erfolgt,
wenn der Führer durch Vorschiebung des Keiles w unter
den Stangenkopf x den Gewichtshebel t wieder hebt.
Bei dem Göpel von R. und T. Elworthy in Elisabethgrod,
Ruſsland (* Erl. D. R. P. Nr. 9374 vom 30. August 1879) wird das Triebwerk aus drei Kegelrädergetrieben gebildet. Das
Hauptrad a (Fig. 6 Taf. 28), an
welches die Deichselschuhe angegossen sind, wird ohne besondere Lagerung auf die in
gleichen Abständen vertheilten Kegelräder c gelegt und
gegen Abhebung durch die in Böcken gelagerten Druckrollen d gehindert. Ein an der Innenseite des Zahnkranzes von a vorspringender Rand r
rollt auf ähnlichen, an den Kegelrädern c vorgesehenen
Rändern s. Da die Berührungsflächen der Ränder r und s mit den
Theilkreisen der Zahnräder a und c zusammenfallen, so soll bei der Bewegung der Räder
nur eine rollende Reibung erzeugt werden.
Die Wellen e und f (Fig. 7 Taf. 28)
der Kegelräder c treffen mit ihren geometrischen Achsen
in dem Mittelpunkte des Hauptrades a zusammen. Die
Bewegung der Wellen e und f wird mittels Kegelräder auf die Kuppelungswelle l übertragen. Zu diesem Zwecke greifen die auf den Wellen sitzenden
Kegelräder g unmittelbar in das Getriebe k der Kuppelungswelle l,
während die Welle e durch ihr Kegelrad m die Kegelräder n
betreibt, welche mit den Rädern g aus einem Stücke
gegossen sind.
Ein Dreiräder-Wendegetriebe benutzt C. Beermann in Berlin (* Erl. D. R. P. Nr. 7207 vom 9.
April 1879), damit bei gleichbleibender Drehungsrichtung der Zugthiere die
Kuppelungswelle zur Arbeitsmaschine sowohl rechts, wie links laufen kann. Auf die
Kuppelungswelle a (Fig. 9 Taf. 28) sind zwei
Kegelräder b und b1 lose aufgesetzt, deren jedes durch die
Zahnkuppelungen c und c1 beliebig eingerückt werden kann, je nach der
gewünschten Umdrehungsrichtung für die Welle a.
Mit der von H. Edelmann in Perleberg (* D. R. P. Nr. 31603 vom 24. Juni 1884) angegebenen
Einrichtung wird bezweckt, vom Göpel drei verschiedene
Geschwindigkeiten zum Betriebe der Arbeitsmaschinen ableiten zu können. Es
sind hierzu zwei Rädervorgelege angeordnet, deren Wellen an jedem Ende zum Aufsetzen
eines Universalgelenkes eingerichtet sind. Bei den in Fig. 10 Taf. 28
angenommenen Uebersetzungen zwischen den Rädern g, h
und k, l würde man 20, 40 und 100 Umdrehungen für die
getriebenen Wellen erzielen. Bezüglich der Anordnung der Räder erscheint es
wesentlich, daſs keines derselben unter die Unterkante des Göpels reicht, daſs also
die Fortschaffung und Aufstellung durch hervorstehende Räder nicht erschwert
ist.
Sämmtliche beweglichen Theile des Göpels sind an einer Grundplatte gelagert; dieselbe
ist mit den vier Lagern der beiden wagerechten Wellen i
und d und der Hülse für das Fuſslager der stehenden
Welle b des groſsen Kegeltriebrades a aus einem Stücke gegossen. Das Rad a
überträgt seine Bewegung
durch das Kegelrad e auf die Welle d. Das ebenfalls auf die Welle d gekeilte Stirnrad g treibt mit dem Rade h die Vorgelegewelle i,
deren Stirnrad l in das lose auf der Welle d laufende Triebrad k
greift, welches gleichzeitig mit einer Kuppelungsklaue ausgerüstet ist. Je nachdem
man die zu treibende Welle mit dieser Klaue oder mit einer der an den Enden der
Welle i zu befestigenden Klauen, oder mit einer Klaue
an dem Ende der Welle d, welche der Mitte des Göpels zu
liegt, verbindet, wird man drei verschiedene Geschwindigkeiten für die zu treibende
Welle erzielen. Beim Linksgange der Zugthiere kann das Getriebe k dahin ausweichen, von woher das Getriebe e seinen Druck empfängt; hierdurch wird das dazwischen
befindliche Lager vom Seitendrucke entlastet.
Für das Getriebe k ist ein Selbstöler vorgesehen. Auf
einer Verlängerung des Getriebes ist die mit einer messingenen Verschluſsschraube
versehene Schmierkammer n aufgegossen und in den Boden
dieser Kammer, unter der Füllöffnung, ein enges Metallrohr eingesetzt; neben diesem
Rohre befinden sich im Boden der Schmierkammer zwei Luftlöcher. Das Oel, welches
sich in der Schmierkammer n befindet, wird bei der
schnellen Umdrehung des Getriebes k nach auſsen
geschleudert und drängt durch die feine Oeffnung des Rohres rückwärts zur Welle, um
dieselbe mit dem erforderlichen Schmiermaterial zu versehen. Löcher im Boden der
Schmierkammer sind für das Eintreten der Luft bestimmt, da sonst kein Oel
ausflieſsen würde; das eine Loch dient für den Rechtsgang, das andere für den
Linksgang des Getriebes.
Eine Vergröſserung der abzuleitenden
Umdrehungsgeschwindigkeit sucht J. Ph. Roemmelt in
Würzburg (* D. R. P. Nr. 33090 vom 23. Januar 1885) dadurch herbeizuführen, daſs,
wie aus Fig.
14 Taf. 28 zu entnehmen ist, auf dem nach unten verlängerten senkrechten
Hauptzapfen a des Göpels ein Kegelräderpaar b eingeschaltet wird. Das Göpelwerk besitzt demnach
drei Räderpaare mit zwei senkrechten Achsen und einer wagerechten Betriebswelle,
aber einem gemeinschaftlichen Lagerbock für die Wellen. Ein auf den hölzernen
Göpelschwellen befestigter Winkeleisenring r, auf
welchem die Göpelzugbäume auf Rollen gleiten, dient zur Entlastung des groſsen
Zugrades c und dessen senkrechter Achse a vom einseitigen Drucke.
Um eine leichte Nachstellung der Zähne von zusammen
arbeitenden Getrieben bei Göpeln zu erreichen, hat A.
Brocksch in Dramburg (* Erl. D. R. P. Nr. 4159 vom 28. März 1878) das
voraussichtlich einer Nachstellung am meisten bedürftige kleine, vom Hauptkegelrade
getriebene Rad auf einen Zapfen gesetzt, dessen Lagertheil excentrisch zur
Befestigungsstelle ist. Werden die Befestigungsschrauben dieses excentrischen
Zapfens gelöst, so ist eine Nachstellung des Triebes gegen das zugehörige Rad durch
Verdrehung des Zapfens um dessen Achse leicht auszuführen.
Eine andere Nachstellvorrichtung von M. und H. S. Rembold in
M.-Gladbach (* Erl. D. R. P. Nr. 10630 vom 12. December 1879) bewirkt die
Nachstellung durch Verschieben des Lagers gegen die Achse des zugehörigen Rades.
Schraubenspindeln mit Gegenmuttern sichern die Entfernung des beweglichen vom
feststehenden Lager bezieh. den gewünschten Eingriff der Zahnräder. Die parallele
gegenseitige Lage der Achsen wird bei beiden Einrichtungen nicht gestört.
Die Scheunen, vor deren Tennen die Göpel zur Verwendung kommen, sind häufig derart
angelegt, daſs mehrere derselben in einem Kreisbogen liegen. Man ist dann genöthigt,
um einen Göpel vor den verschiedenen Tennen arbeiten zu lassen, denselben
fortwährend hin- und herzurücken, was zeitraubend und schwierig ist. Dieser
Uebelstand soll durch die Anordnung eines im, Kreise
verstellbaren Vorgeleges nach dem in Fig. 13 Taf. 28
veranschaulichten Vorschlage von J. S. Kern in
Schwiebus (* D. R. P. Nr. 24094 vom
27. Januar 1883) vermieden werden.
Auf der Grundplatte A ist die das Vorgelege tragende
Platte B beweglich angeordnet; ihren Drehpunkt hat die
Platte B in dem Zapfen D
und ihre Führung und Feststellung auf den gewünschten Punkt findet durch die
Sicherungsbahn C statt, welche zwei Drittel eines
Kreises beschreibt. Diese Bahn C ist auf der oberen
Fläche mit einer Nuth f versehen, in welcher sich eine
an der unteren Fläche der Vorgelegeplatte B befindliche
Nase bewegt. Diese Nase dient zur Feststellung der Vorgelegeplatte. Je nach der
Stellung, welche die Vorgelegeplatte B erhalten hat,
drücken zwei oder drei der an dem äuſseren Umfange des Führungsschlittens C angebrachten Schrauben s
auf die Nase und klemmen dieselbe unverrückbar in der Nuth f fest. Der Zapfen D, um welchen die
Vorgelegewelle sich dreht, dient zugleich als Achse für das in das groſse Triebrad
eingreifende Zahnrad G und für das Kegelrad H.
Wenn das Hauptrad sich um einen feststehenden Zapfen dreht, so wurde dieser Zapfen
entweder mit der Grundplatte aus einem Stücke gegossen, oder besonders aus
Schmiedeisen eingesetzt. Der schmiedeiserne Zapfen wird, wenn er von genügender
Stärke gemacht wird, zu theuer; der guſseiserne Zapfen, welcher die genügend groſse
Oberfläche darbietet, um die hohle Radnabe sicher auf demselben laufen zu lassen,
kann, wenn trotz seiner groſsen Oberfläche endlich doch die einseitige Abnutzung
eintritt, nicht ausgewechselt werden und dann ist die ganze Grundplatte unbrauchbar.
Th.
Flöther in Gassen i. L. (* D. R. P. Nr. 21130 vom 16. August 1882) wendet deshalb
gemäſs Fig. 8
Taf. 28 für das Hauptrad R einen leicht zu verstellenden
guſseisernen Hohlzapfen z an, welcher unten eine breite Flansche f für die Auflage auf der Grundplatte besitzt. Mittels
des Splintbolzens b wird der Zapfen z, der überdies mit einem Ansätze in die Grundplatte
eingreift, sodann mit der letzteren verbunden. Diese Verbindung ist mittels einiger
Hammerschläge zu lösen und wieder herzustellen: dadurch ist die Möglichkeit geboten, den Zapfen z vor einseitiger Abnutzung zu bewahren, indem man
denselben von Zeit zu Zeit etwas dreht.
Das Gewicht des Hauptrades R wird durch eine Stahlplatte
s aufgenommen, welche in einer Ausfalzung des
hohlen Zapfens ruht. Die Flansche f hat eine ringsum
laufende Nuth, welche als Oelbehälter dient.
Wird ein Göpel zur Schachtförderung benutzt
(Schachtgöpel), so kann bei einem Seil- oder Kettenbruche in Folge des
Zurückschlagens des Göpels leicht eine Beschädigung des Zugthieres herbeigeführt
werden. Zur Abwendung dieser Gefahr bringt C. Loesch in
Oppeln (* Erl. D. R. P. Nr. 18203 vom 21. September 1881) eine selbstthätige Hemmvorrichtung an. Der Göpel wird mit
einem auf dem Bodengestelle fest verbundenen Zahnkranze versehen, in welchen an
beiden Seiten des Zugbaumes je eine Sperrklinke eingreift. Diese Klinken sitzen an
je einer Stange, welche an beiden Seiten des Zugbaumes hinlaufen und an dessen Ende
mit je einem Hebel versehen sind. Die Hebel werden durch den Haken beim Anziehen des
Zugthieres so bewegt, daſs die in der Zugrichtung liegende Sperrklinke ausgehoben
wird, während die andere Sperrklinke regelmäſsig hinter jedem Zahne des Zahnrades
einfällt und so beim etwaigen Rücklaufe sofort hemmt.
(Schluſs folgt.)
Tafeln