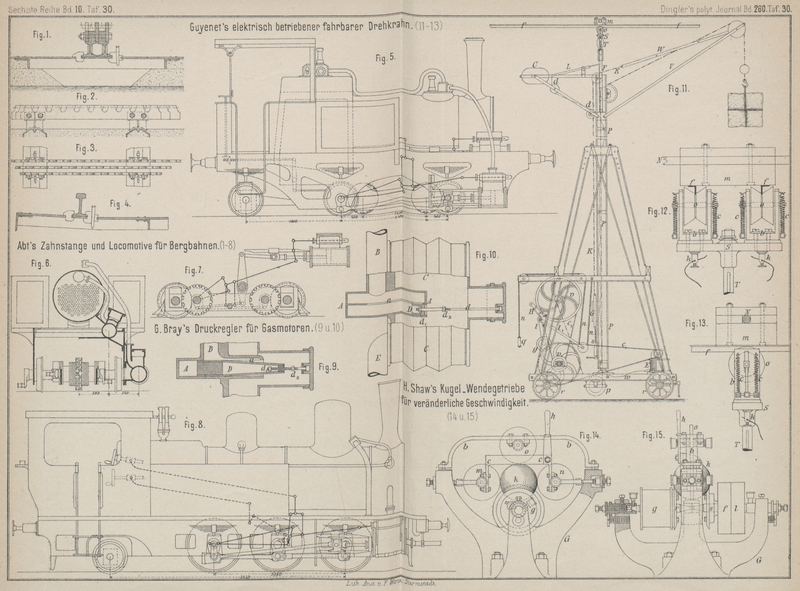| Titel: | Elektrisch betriebene Hebezeuge für Lagerhäuser, Werkstätten u. dgl. |
| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 499 |
| Download: | XML |
Elektrisch betriebene Hebezeuge für Lagerhäuser,
Werkstätten u. dgl.
Mit Abbildungen auf Tafel
30.
Elektrisch betriebene Hebezeuge für Lagerhäuser u. dgl.
In dem ausgedehnten Wolllagerhause zu Roubaix, welches der Compagnie des
Entrepóts et Magasins généraux in Paris gehört, ist nach dem Génie
civil, 1885/6 Bd. 8 * S. 364 bezieh. der Revue industrielle, 1886 * S. 134 ein elektrisch betriebener, fahrbarer Drehkrahn in
zufriedenstellender Benutzung. Die Einrichtung desselben ist dadurch beachtenswerth,
daſs bei der Beweglichkeit des Hebezeuges auch die Contacte für die Leitung des
elektrischen Stromes zum bewegenden Elektromotor wie bei einer Eisenbahn beweglich
sein müssen. Bei dem vorliegenden, in Fig. 11 Taf. 30
dargestellten Krahne erfolgt die Elektricitätsleitung zum Elektromotor durch an der
Decke des Lagerhauses entsprechend den darin für die Bewegung des Krahnes frei
bleibenden Gängen angebrachte Schienen f. Der Krahn
läuft mit seinen Rädern r nicht auf Schienen, sondern
frei auf dem gewöhnlichen Fuſsboden, weshalb eine besondere Einrichtung zur
Sicherung der Berührung zwischen den Contactrollen o
und den Schienen f nöthig ist.
Die Ausführung des Krahnes bis auf den elektrischen Betrieb hatte Guyenet in Paris, den Entwurf und die Ausführung der
Einrichtung zur elektrischen Arbeitsübertragung die Compagnie électrique in Paris übernommen. Die hohle, 7m,3 hohe Krahnsäule P
ruht mit einem hohlen Fuſszapfen in einem am Boden des Wagens w angebrachten Spurlager und wird im oberen Theile von
einem Rollenlager eines hölzernen Gerüstes gehalten. An die Säule P ist der scherenartige Ausleger F angeschlossen, für welchen wie gleichzeitig für die
Last auf der anderen Seite ein festes Gegengewicht C
vorgesehen ist. Die obere Schiene W des Auslegers ist
an eine Kette K gehängt, durch deren Verlängerung oder
Verkürzung mittels einer Schraube s die Ausladung
verändert wird. Die
Lastkette geht durch die hohle Krahnsäule P über eine
unterhalb am Wagen w sitzende Rolle p zur Windetrommel u,
welche durch ein Vorgelege v1 mittels der beiden Riemen c1 und c2 von dem Elektromotor E angetrieben wird. Während der Riemen c1 straff um seine Scheiben gelegt ist, läuft der
Riemen c2 ganz schlaff,
so daſs derselbe im gewöhnlichen Zustande die Scheibe der Windetrommel nicht
mitzunehmen vermag. Eine Mitnahme der letzteren und somit ein Anheben der Last
erfolgt nur, wenn der Riemen c2 mittels der Laufrolle g gespannt wird. Diese Laufrolle g sitzt an
dem einen Arme l eines Winkelhebels, dessen anderer Arm
l1 eine Seilrolle
trägt und mit welchen gleichzeitig die Bremse H in
Verbindung gebracht ist. Ueber die Rolle des Armes l1 geht die Schnur n,
durch welche bei deren Anziehen der Riemen c2 gespannt wird. Durch entsprechenden Zug an der
Schnur n, welche zur Strafferhaltung mit einem Gewichte
q versehen ist, hat man es in der Gewalt, den
angehängten Wollballen, dessen Gewicht zwischen 400 und 600k schwankt, mit verschiedener Geschwindigkeit zu
heben, in der Höhe zu erhalten und herab zu lassen. Der Elektromotor E kann dabei beständig mit seiner regelmäſsigen
Geschwindigkeit von 900 Umgängen in der Minute fortlaufen.
Die Leitungsschienen f sind, wie im Besonderen noch aus
Fig. 12
und 13 Taf.
30 zu ersehen ist, an den Stäben N der Dachsparren
mittels untergelegter Holzklötzchen m, welche zur
Isolirung dienen, befestigt. Die im stumpfen Winkel ausgedrehten Contactrollen o werden mit ihren Zapfen in Böckchen b geführt und durch Federn c immer nach oben gezogen. Der Träger für diese Böckchen b besteht aus 3 Theilen: dem an der Krahnsäule P befestigten Rohre F, in
welchem mittels Keil und Nuth die Spindel T verschiebbar ist; auf letzterer ist die mit den
beiden Leitungsdrahtklemmen k versehene Platte S drehbar. In das Rohr F
tritt von der Seite das Ende eines zweiarmigen Hebels L, welches unter das Ende der Spindel T greift
und dieselbe stützt. An das andere Ende des Hebels L
ist eine Schnur d geknüpft, welche über Rollen an die
Säule P geleitet ist und an der unten das Gewicht G hängt. Durch das letztere wird folglich ein
beständiger Andruck der Contactrollen o an die Schienen
f gesichert.
Die zum Betriebe dieses Krahnes aufgestellte Strom erzeugende Dynamomaschine ist wie
auch der Elektromotor von Gramme'scher Anordnung. Die
erstere gebraucht bei 1200 minutlichen Umläufen 6,5 Pferd, während der letztere etwa
4 Pferd bei 900 Umläufen in der Minute abgibt; dabei kann eine Last von 500k in 25 Secunden 8m gehoben werden. Der elektrische Strom hat eine Stärke von 15 Ampère bei
einer Spannung von 250 Volt. Die Nutzleistung wäre hiernach etwa 31 Proc.; doch
kommt dieselbe für die Anlage eines Krahnes in einem Wolllager nicht allein in
Betracht. Es ist in solchen bisher aus vielfachen Gründen die Aufschichtung und
Wegschaffung der Ballen durch Arbeiter bewerkstelligt worden; während nun früher zur
Aufschichtung von 150 Ballen in 20 Stunden 10 Arbeiter nöthig waren, führen diese
Arbeit mit dem beschriebenen Erahne 4 Arbeiter in 3 Stunden aus.
Bereits früher hatte die Compagnie électrique in Paris
in der Eisengieſserei von J. Farcot in St. Ouen bei
Paris einen Drehkrahn für elektrischen Betrieb
eingerichtet. Nach der Revue industrielle, 1885 * S.
293 bezieh. dem Portefeuille economique des machines,
1885 * S. 114 oder dem Génie civil, 1885 Bd. 7 * S. 200
ist in einem 90m von dem Standorte des Krahnes
gelegenen Maschinenhause die Strom erzeugende Dynamomaschine neben einer gleichen
Dynamomaschine für Beleuchtungszwecke aufgestellt. Beide Maschinen sind so
eingerichtet, daſs sie sich im Nothfalle gegenseitig ersetzen können. Bei einer
Geschwindigkeit von 1550 Umläufen beträgt die Klemmenspannung der Dynamomaschine 350
Volt, die Stromstärke 13 und selbst 15 Ampère bei besonderer Anstrengung des
Krahnes. Der Elektromotor auf letzterem macht etwa 1000 Umläufe. Von demselben wird
bei gleichbleibender Geschwindigkeit das Heben, der Stillstand und das Senken der
Last mittels einer Mégy'schen Sicherheitsbremse (vgl.
1874 213 * 108) hervorgebracht. Die Windetrommel des
Krahnes kann zwei verschiedene Geschwindigkeiten erhalten; bei der groſsen
Geschwindigkeit kann eine Last von 6t in der
Minute 1m,25, bei der kleineren Geschwindigkeit
ein Last von 20t in der Minute 0m,35 gehoben werden. Der Nutzeffect zwischen der
Strom gebenden Dynamomaschine und dem Elektromotor ist 65 Proc., zwischen ersterer
und der Leistung des Krahnes rund 38 Proc. Während jedoch früher bei Handbetrieb 10
Arbeiter für die Bewegung des Krahnes nöthig waren, reicht jetzt für die Steuerung 1
Mann aus und das Heben erfolgt schneller, während das Niederlassen weit sicherer und
gleichmäſsiger vor sich geht.
J. Jaspar in Lüttich hat für die Förderung von
beliebigen Lasten von der Straſse aus in seine Werkstätten, welche 5m,25 über der Straſsenebene liegen, den Betrieb einer schiefen Ebene elektrisch eingerichtet.
Auf der schiefen Ebene läuft eine Bühne, welche an einer Gelenkkette angehängt ist
und von einer Windetrommel die 40 Proc. betragende Steigung hinan gezogen wird. Die
Rollbühne ist nach der Revue industrielle, 1885 * S.
375 7m,65 lang und 2m,05 breit, so daſs dieselbe selbst groſse Lastwagen aufnehmen kann. Die
Spurweite ist 1m,80. Für die Bühne ist an einer
von der Windetrommel ablaufenden und nach Art eines Flaschenzuges geführten Kette
ein Gegengewicht vorhanden, so daſs nur das wirkliche Lastgewicht zu heben ist. Der
Antrieb der Windetrommel erfolgt durch mit Spuren in einander greifende
Reibungsräder, wobei das kleinere Rad an einem stellbaren Hebel sitzt, welcher durch
eine Zugstange mit der Bremse in Verbindung steht. Das ganze Windewerk liegt
versenkt und erfolgt der Betrieb des kleinen Reibungsrades durch ein doppeltes
Riemenscheibenvorgelege von dem frei stehenden Elektromotor. Dieser und die Strom erzeugende
Dynamomaschine sind von Gramme'scher Anordnung und die
Nutzleistung zwischen beiden beträgt etwa 55 Proc. Das Gewicht der zu hebenden Last
schwankt zwischen 4 und 6t. (Vgl. Siemens und Halske 1881 239
* 22. Siemens und Hopkinson 1883 249 162. Freisler 1883 250 471.)
Tafeln