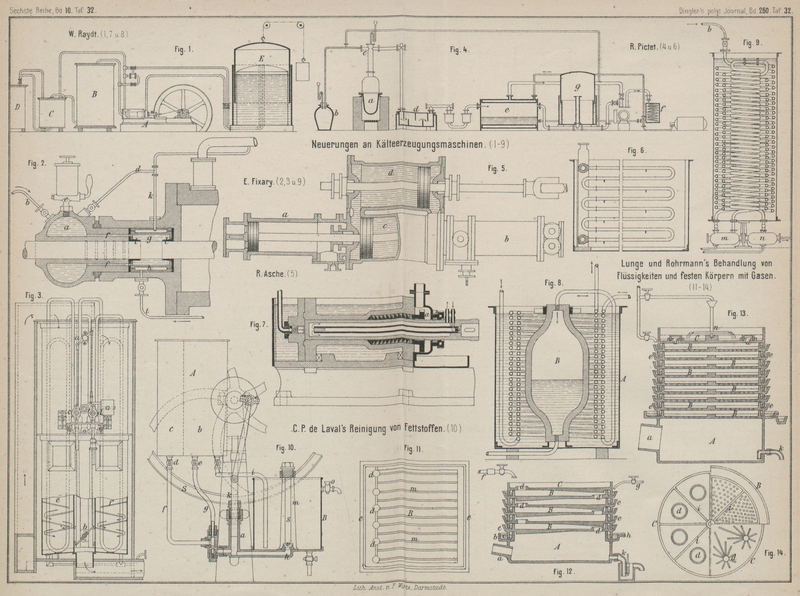| Titel: | Apparat zur Einwirkung von Gasen auf Flüssigkeiten oder feste Stoffe. |
| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 509 |
| Download: | XML |
Apparat zur Einwirkung von Gasen auf
Flüssigkeiten oder feste Stoffe.
Mit Abbildungen auf Tafel
32.
Behandlung von Flüssigkeiten u.a. mittels Gasen.
G.
Lunge in Zürich und L. Rohrmann in Krauschwitz
bei Moskau (* D. R. P. Kl. 12 Nr. 35126 vom 4.
August 1885) benutzen, um Gase mit festen Stoffen oder Flüssigkeiten in
möglichst innige Berührung zu bringen, den in Fig. 12 Taf. 32
dargestellten Apparat. Der unterste Trog A desselben
ist mit dem Gaseinströmungsrohre a und dem Ablaufrohre
k für die Flüssigkeit versehen. Der obere Rand von
A bildet eine Rinne b,
in welche man zur Bildung eines Wasserverschlusses den nach unten ragenden Rand c einer Platte B gestellt
hat. Der obere Rand dieser Platte bildet wieder eine Rinne e, in welcher der Rand c einer folgenden
Platte B steht, und so sind immer unter Bildung eines
Wasserverschlusses zwischen je einem Rande c und je
einer Rinne e noch viele folgende Platten B von gleicher, in Fig. 11 Taf. 32 durch
eine obere Ansicht veranschaulichten Einrichtung auf einander gethürmt.
An einer Seite jeder Platte B, und zwar von Platte zu
Platte versetzt, befindet sich eine Reihe von Löchern d, welche an der Oberfläche der Platte von einem niedrigen Wulste eingefaſst
werden. Der andere Theil der oberen Fläche der Platten ist vollständig eben und
wagerecht, während die untere Fläche etwas geneigt ist und zwar so, daſs jedesmal
unter den Löchern d die stärkste Stelle liegt. Man kann
auch, wie aus Fig.
11 bei m ersichtlich ist, auf der unteren
geneigten Fläche der Platten seichte, von den Löchern d
ausgehende Vertheilungsrinnen anbringen.
Soll eine gegenseitige Einwirkung zwischen einem Gase und einer Flüssigkeit
stattfinden, so läſst man ersteres durch Rohr a in den
Trog A treten, letztere aus Rohr f auf die oberste Deckplatte C strömen, deren Einrichtung mit derjenigen der übrigen Platten
übereinstimmt. Will man jedoch die den Apparat verlassenden Gase noch weiter leiten,
so fügt man an die Löcher d dieser Platte C die Fortleitungsrohre mittels eines
Wasserverschlusses an. Das Gas durchströmt den Apparat, während es durch die Löcher
d aufsteigt, in zickzackförmiger Bahn und kommt
hierbei in die innigste Berührung mit der Flüssigkeit, welche – die niedrigen, die
Löcher d umgebenden Wulste übersteigend – von Platte zu
Platte niedersinkt, um schlieſslich in möglichster Concentrirung aus dem Troge A durch das Rohr k
abzulaufen.
Das Gas kommt nicht nur in Berührung mit der dünnen, auf
jeder Platte B ausgebreiteten Flüssigkeitsschicht,
sondern auch mit derjenigen Schicht der Flüssigkeit, welche sich in Folge der
Adhäsion an der unteren geneigten Fläche der Platten herniederzieht, so daſs eine
sehr ausgedehnte Berührung und damit gründliche Einwirkung zwischen Gas und
Flüssigkeit stattfindet.
Zur Bildung der Wasserverschlüsse läſst man aus dem Hahne g Wasser oder eine andere passende Flüssigkeit in die oberste Rinne e flieſsen. Von Rinne zu Rinne strömt das Wasser durch
abwechselnd auf entgegengesetzten Seiten liegende Ueberläufe nieder, um schlieſslich
aus der Rinne b des Troges A bei h abzuflieſsen. Dieser
Flüssigkeitsstrom in den Wasserverschlüssen läſst sich unter Umständen auch
vortheilhaft zur Kühlung des Apparates verwenden.
Bei einer zweiten Ausführung sind die Platten B (Fig. 13 und
14 Taf.
32) mit zahlreichen Löchern versehen, deren Gesammtquerschnitt gröſser ist als
derjenige des Gaszuleitungsrohres a. Um die dünne
Flüssigkeitsschicht auf den Platten möglichst gleichmäſsig zu vertheilen, ist die obere Fläche
durch Rippen i in einzelne Abtheilungen zerlegt.
Dieselbe Einrichtung zeigt auch die Deckplatte C (Fig. 14
links), nur hat diese einzelne gröſsere Oeffnungen d.
Zur gleichmäſsigen Verkeilung der Flüssigkeit auf der Deckplatte C bedient man sich vortheilhaft eines Reactionsrades
n.
Um die Flüssigkeit, welche durch die Platte C strömt,
gleichmäſsig über die folgende Platte zu vertheilen, kann man auf der unteren Fläche
von C strahlenförmig von den Löchern d ausgehende Furchen anbringen (vgl. Fig. 14 rechts
unten).
Sollen Gase auf feste oder breiförmige Stoffe einwirken, so kann man die Platten B einzeln mit den festen oder breiförmigen Massen
beschicken und zur Wegräumung der behandelten Stoffe wieder einzeln von einander
abheben. Der in Fig. 11 und 12 dargestellte Apparat
dürfte zu einer derartigen Behandlung pulverförmiger oder breiartiger Masse, der in
Fig. 13
und 14
dargestellte zur Behandlung von gröſseren Stücken oder grobkörnigen Stoffen den
Vorzug verdienen. Der Apparat kann aus künstlichem Stein, gebranntem Thon, Glas,
Metall, Holz oder beliebigem anderem Materiale dargestellt werden, wie die Platten
auch statt der gezeichneten viereckigen oder runden Form jede andere Gestalt
erhalten können.
Tafeln