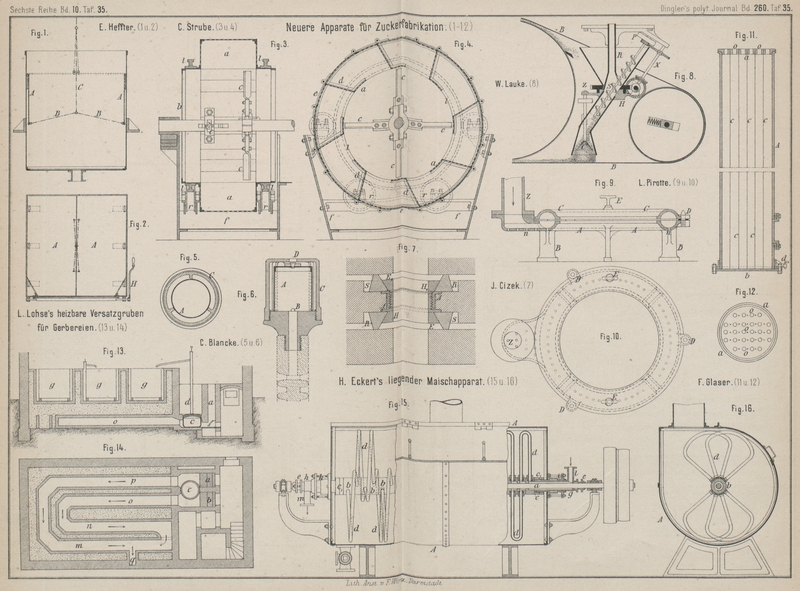| Titel: | Ueber neuere Apparate für Zuckerfabrikation. |
| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 560 |
| Download: | XML |
Ueber neuere Apparate für
Zuckerfabrikation.
(Patentklasse 89. Fortsetzung des Berichtes Bd.
258 S. 357.)
Mit Abbildungen auf Tafel
35.
Neuere Apparate für Zuckerfabrikation.
Bei der in Fig.
3 und 4 Taf. 35 dargestellten Rübenwaschmaschine
von C. L.
Strube in Buckau-Magdeburg (* D. R. P. Nr. 34241 vom 19.
Juni 1885) werden die mittels Schwemme herangeschafften Rüben seitlich
bei b in die Trommel a
geführt. Diese ist mit nach innen offenen Fächern d von
Draht, durchlochtem Blech o. dgl. versehen, welche am äuſseren Umfange Klappen e tragen. Ferner befinden sich an den Seiten der
Trommel Laufkränze l, welche in Rollen r ruhen, um eine leichte Drehung der Trommel nach
rechts oder links hervorrufen zu können. Die Rollen sind in dem mit Wasser gefüllten
Kasten f gelagert und dienen gleichzeitig zur Führung
der Trommel.
Wird die Welle mit den Quirlen c in Umdrehung versetzt,
so werden die Rüben durch einander gerührt und es lösen sich die schweren Theile,
welche nach unten sinken und so in die unteren Fächer d
gelangen. Sollen die mit Steinen u. dgl. gefüllten Fächer d entleert werden, so dreht man die Trommel a
so, daſs die Fächer bis über den Rand des Wasserkastens f kommen, und öffnet alsdann die Klappen e.
Die angesammelten Steine können so während des Betriebes entfernt werden.
W. Lauke in Trendelbusch und W. Huch in
Hannover (* D. R. P. Nr. 34238 vom 23. April 1885) empfehlen, Schnitzelpressen mit selbstthätigem Zuführungsrumpfe zu
versehen. Der trichterförmige Rumpf R (Fig. 8 Taf. 35) trägt an
seinem verjüngten Ende das Schneckenrad Z, welches
mittels eines Vorgeleges X von der Riemenscheibe P aus auf seinem Sitze bei H und damit der Rumpf R selbst gedreht wird.
Die in den Rumpf R fallenden Schnitzel, welche als
träge Masse nicht weiter gleiten würden, werden durch die langsame Drehung der
Schnecke S so zugeführt, daſs sämmtliche auf den
Wandungen lagernden Massen nach einander unten ausgeschneckt werden. Stehen die
Drehungsgeschwindigkeiten von Schnecke und Rumpf bezieh. Trichter in einem passenden
Verhältnisse, so werden stets so viel Schnitzel fortgeschneckt werden, als durch die
Trichterdrehung seitlich nach der Schnecke zugeführt wird. Die gleichmäſsige
Vertheilung der Schnitzel auf das endlose Band B der
Presse erfolgt durch den rasch gedrehten gerippten Kegel C.
Nach J.
Cizek in Kwassitz, Mähren (* D. R. P. Kl. 58 Nr. 35160 vom 10. Juni 1885) werden die Kanalabdichtungen für Filterpressen durch elastische
Ringe bewirkt. Die Platte oder der Rahmen wird, wie aus Fig. 7 Taf. 35 zu ersehen
ist, auf beiden Seiten um die den Kanal bildende Oeffnung herum genügend tief
eingedreht, um Raum für die einzusetzenden Gummiringe R
zu schaffen. Im Inneren des Kanales befinden sich die verschraubten Ringe H und H1 welche zum Zwecke des Festhaltens im Kanäle mit
den Flanschen A versehen sind, die sich an die Platte anlegen. Die Form
der Ringe H und H1 ist derartig, daſs ihre vorderen Theile E bezieh. E1 Kegel bilden, welche die Dichtungsringe R in den Nuthen S
halten.
Für Filterpressen bringen C. W. Julius Blancke und Comp. in
Merseburg (* D. R. P. Kl. 58 Nr. 34530 vorn 15. März 1885) selbstthätig wirkende Entlüftungsventile zur Ausführung. Wie in Fig. 5 und 6 Taf. 35
veranschaulicht ist, befindet sich in einem oben mit einer Oeffnung D versehenen Gehäuse C ein
glockenförmiger Schwimmer A, welcher unten mehrere
Einschnitte B besitzt und oben eine Gummiplatte trägt.
Dieser Schwimmer bewegt sich innerhalb dreier Führungen (vgl. Fig. 5) in dem
übergeschraubten Gehäuse C.
Sobald die Auslaugeflüssigkeit in die Filterpresse eintritt, wird die in den
Riffelungen der Platten befindliche Luft nach oben in die Glocke A gedrängt, aus welcher sie durch die Einschnitte B um die Glocke herum und weiter durch die Oeffnung D ins Freie entweicht. Sobald alle Luft aus der Presse
entfernt ist, wird die Auslaugeflüssigkeit in die Glocke gedrängt, welche diese zum
Schwimmen bringt, wodurch die Oeffnung D geschlossen
wird. Wenn nach beendeter Auslaugung die Ablaufhähne an den Filterplatten geöffnet
werden, so hört der in der Presse befindliche Druck auf; in Folge dessen sinkt der
Schwimmer A und gestattet den Eintritt der Luft durch
die Oeffnung D. Die in den Riffelungen noch
zurückgebliebene Auslaugeflüssigkeit kann nun vollständig abflieſsen, wodurch man
ganz trockene Kuchen erhält.
E.
Heffter in Altjauer a. d. Neiſse (*
D. R. P. Nr. 34666 vom 30. Juni 1885) bringt zum Abheben der Schlamm- und Schaumdecke von Zuckersäften
in einer viereckigen Pfanne zwei siebförmige Platten oder Rahmen A (Fig. 1 und 2 Taf. 35) an, welche
mittels Ketten B verbunden sind. Wird die Kette C mittels einer anderen Kette, welche oben über Rollen
geführt wird, gezogen, so heben sich die Siebe A und
nehmen die punktirt angedeutete wagerechte Lage ein. Bei dieser Lage der Siebe kann
man mit einem Schlauche die Oberfläche der Siebe abspülen und den Schaum mit einer
Krücke entfernen. Zum besseren Entfernen des Schaumes kann an der einen Wand der
Pfanne eine Klappe angebracht werden, welche mittels des Hebels H geöffnet und wieder geschlossen wird.
Der von L.
J. Pirotte in Brüssel (* D. R. P. Nr. 34680 vom 15. September
1885) angegebene Apparat zur Einführung von
Kohlensäure in die mit Kalk geschiedenen Zuckersäfte besteht aus einer mit
Handhaben E (Fig. 9 und 10 Taf. 35) versehenen,
hohlen unteren Ringhälfte A, welche mit der
Kohlensäurezuleitung Z verbunden und auf den Füſsen B in den Saturateur eingestellt wird. Auf diese
Ringhälfte ist eine gleichfalls hohle Ringhälfte C
aufgesetzt und wird die obere auf der unteren Ringhälfte mittels der durch A geschraubten Stifte D
gehalten. Jeder der letzteren ist mit einem Bunde oder Ringe versehen, auf welchen
sich die obere
Ringhälfte aufsetzt, so daſs zwischen derselben und der unteren Ringhälfte ein
ringsum laufender engerer oder breiterer Spalt verbleibt, durch welchen die
Kohlensäure allseitig ausspritzt.
Die untere Ringhälfte ist ferner an der Unterseite mit Löchern n versehen, welche zum Austreiben des im Apparate
ausgefällten, oder sich demselben anhängenden Saturationsschlammes bestimmt sind und
gleichzeitig dadurch, daſs sie Kohlensäure in Strahlen gegen den Boden des
Saftbehälters ausspritzen lassen, jedes vorzeitige Setzen des Schlammes
verhindern.
Um nach F.
C. Glaser in Berlin (* D. R. P. Nr. 35116 vom 10. Oktober
1885) beim Krystallisiren von Kandiszucker
möglichst Krystalle in Stangen zu bekommen, sollen hohe cylindrische Gefäſse
verwendet werden. Der Deckel a (Fig. 11 und 12 Taf. 35)
und der Boden b des Gefäſses A können leicht abgenommen werden. Beide sind mit kleinen Löchern zur
Aufnahme der in senkrechter Richtung eingespannten Schnüre c versehen. Zum Eingieſsen des flüssigen Zuckers dienen die zwischen den
Fadenlöchern im Deckel angebrachten Oeffnungen o. Das
Gefäſs kann aus verzinktem Eisen, Kupfer, Messing oder einem sonst geeigneten
Materiale bestehen. Nach beendeter Krystallisation läſst man das Stürzel durch einen
nahe am Boden befindlichen Hahn d ab. Die Krystalle
werden, nachdem die Fäden am Deckel abgeschnitten sind, unten herausgenommen und die
Bodenstücke von dem losgeschraubten Boden einfach abgestoſsen.
Tafeln