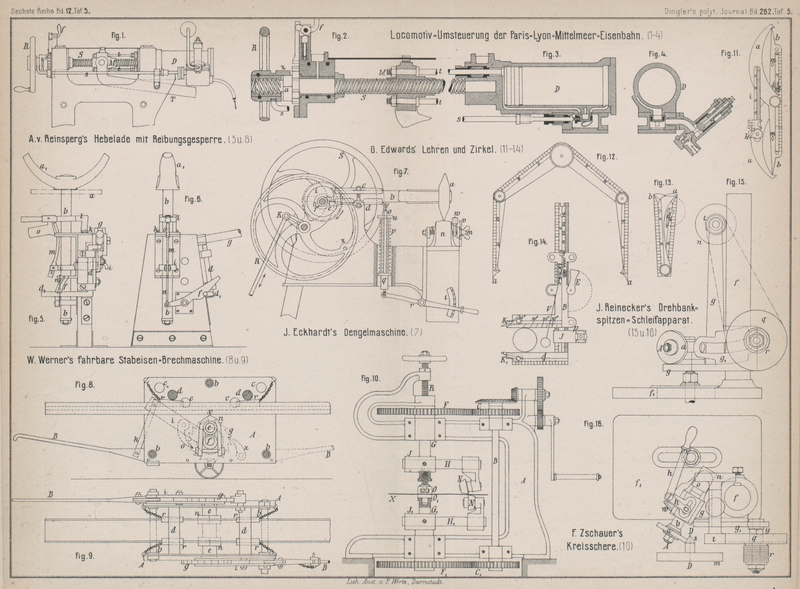| Titel: | J. E. Reinecker's Drehbankspitzen-Schleifapparat. |
| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 68 |
| Download: | XML |
J. E. Reinecker's
Drehbankspitzen-Schleifapparat.
Mit Abbildungen auf Tafel
5.
Reinecker's Drehbankspitzen-Schleifapparat.
Einen Apparat, welcher die Spitzen von Drehbänken unter beliebigen Winkeln ohne
Zuhilfenahme des Drehbanksupportes anzuschleifen gestattet, hat J. E. Reinecker in Chemnitz (* D. R. P. Kl. 49 Nr.
36186 vom 29. Oktober 1885) ausgeführt. Dieser Apparat ist in Fig. 15 und 16 Taf. 5
dargestellt. Das Gestell desselben ist von einer Säule f gebildet, welche mittels ihrer Grundplatte f1 auf der Drehbankwange festgeschraubt
werden kann. Der ganze Schleifapparat ist entlang der Säule f verschiebbar und durch Klemmschrauben in beliebiger Höhenlage
feststellbar. Hierdurch ist es möglich, die Spindel A
der Schleifscheibe a in gleiche Höhe mit der
Drehbankspitze s zu bringen. Die Drehung des
Schleifapparates um die Säule f ist durch Nuth und
Feder verhindert, so daſs jedesmal, wenn die Kanten der rechtwinkligen Fuſsplatte
f1 parallel bezieh.
rechtwinklig gekreuzt zu der Drehbankspindelachse DD liegen, auch das Gestell g des
Schleifapparates die gleiche Richtung zur Drehbankspindel hat.
Der Antrieb der Schleifscheibe erfolgt unmittelbar durch die Mitnehmerscheibe m der Drehbank und zwar entweder, indem man die Scheibe
m mit der ledernen Antriebsrolle r durch einen Riemen o. dgl. verbindet, oder indem man
r und m als
Reibungsräder mit einander arbeiten läſst. Durch Drehung von r wird das offene Riemengetriebe q, t bewegt,
welches mittels eines theilweise geschränkten Riementriebes n, o die Schleifscheibenspindel A treibt.
Letztere ist zur Veränderung des zu schleifenden Spitzenwinkels um eine senkrechte
Achse dreh- und feststellbar und in der wagerechten Ebene durch die
Drehbankspindelachse wegen der Anstellung der Schleifscheibe a senkrecht zu ihrer Richtung verschiebbar. Einer ungleichmäſsigen
Abnutzung der Schleifscheibe wird durch eine mittels eines Hebels h ausführbare Hin- und Herbewegung der Lagerbüchse b, in welcher die Schleifscheibenspindel A unverschiebbar lagert, vorgebeugt. Die Eintheilung
w dient zum Einstellen der um eine senkrechte Achse
drehbaren Platte der Büchse b, um bei verschiedenen
Drehbänken genau ein und denselben Spitzenwinkel herstellen zu können. In einem
Bogenschütze g1 ist die
Achse der Scheiben q und r
verstellbar und durch die Schraubenmutter y
festklemmbar, so daſs man
den Scheiben m und r
innerhalb gewisser Grenzen beliebigen Abstand geben bezieh. verschieden groſse
Scheiben m anwenden kann. (Vgl. 1873 208 * 3.)
Tafeln