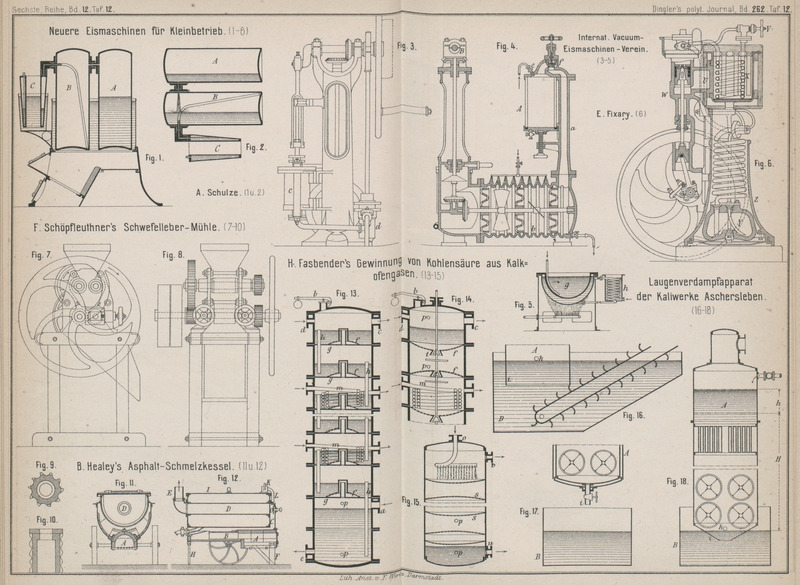| Titel: | Neuere Eismaschinen für Kleinbetrieb. |
| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 173 |
| Download: | XML |
Neuere Eismaschinen für Kleinbetrieb.
Patentklasse 17. Mit Abbildungen auf Tafel 12.
Neuere Eismaschinen für Kleinbetrieb.
Der allgemeine Aufschwung, welchen der Bau von Eismaschinen im letzten Jahrzehnte
genommen hat, erweckte auch das Verlangen nach Maschinen, welche gestatten, geringe Mengen Eis, wie sie für Haushaltungszwecke nöthig sind, womöglich mit
Handbetrieb zu erzeugen. Der erste Schritt in dieser Richtung scheint von
E. Carré vor etwa 10 Jahren gemacht worden zu sein
mit einer kleinen Schwefelsäuremaschine (vgl. 1875 217 146), welche auf dem später von Windhausen in seiner Vacuummaschine angewendeten
Verfahren beruht, Wasserdämpfe von Schwefelsäure absorbiren zu lassen.
Ein neuerer Apparat von A. Schulze in Halle a. d. Saale (* D. R. P. Nr. 35826 vom 14. November 1885) benutzt das System der Ammoniakabsorption und liegt demselben der Gedanke
zu Grunde, alle Hähne, Ventile und sonstige bewegliche Theile, als die Hauptursachen
von Betriebsstörungen bei kleinen Maschinen, zu vermeiden. Es ist dies, wie aus Fig. 1 und 2 Taf. 12
ersichtlich, auf folgende Weise erreicht: In einem Kesselt (Fig. 1) befindet sich der
Salmiakgeist, aus welchem durch Erhitzen in einem Wasser- oder Salzwasserbade das
Ammoniak ausgetrieben werden soll. Letzteres geht durch den Absorptionskessel B, welcher ebenfalls im Heizbade steht, nach dem
Eiserzeuger C und wird dort durch Abkühlung als
Flüssigkeit niedergeschlagen. Ist die Destillation beendet, so bringt man den
Apparat in die Stellung Fig. 2, wodurch die
erschöpfte Lösung aus dem Kessel A in das
Absorptionsgefäſs B flieſst. Wird hierauf der Apparat
wieder in die ursprüngliche Lage gebracht, aber der Absorptionskessel B in kaltes Wasser gestellt, während der Eiserzeuger
C in das in Eis zu verwandelnde Wasser getaucht
wird, so verdampft das im Eiserzeuger angesammelte flüssige Ammoniak, wobei es dem
Eisbildner Wärme entzieht. Nach beendeter Eisbildung bringt man den Apparat in die
umgekehrte Lage, wie in Fig. 2 angedeutet, so daſs
die gesättigte Salmiaklösung wieder in den Kessel A
zurückflieſsen kann, und die Maschine ist zu erneuter Wirkung bereit.
Handlicher im Betriebe erscheint die von dem Internationalen
Vacuum-Eismaschinen-Verein in Berlin (* D. R. P. Nr. 36055 vom 17. Oktober
1885) angegebene, in Fig. 3 bis 5 Taf. 12 dargestellte
kleine Vacuum-Kältemaschine; dieselbe ist im
Wesentlichen der Windhausen'schen Vacuummaschine (vgl.
1884 252 * 369. 1886 259 *
262) nachgebildet, nur in möglichst gedrängter, für den Handbetrieb geeigneter
Anordnung.
Der Eisbildner besteht aus einem an den Endflächen gerade geschliffenen, zwischen
Gummiringen eingepreſsten Glascylinder A, der unten
durch einen stellbaren Boden geschlossen ist und dessen Deckel durch ein Rohr a mit dem Absorptionsgefäſse b in Verbindung steht. Letzteres wird gebildet von einem Cylinder aus
Guſseisen oder Hartblei, der theilweise mit Schwefelsäure gefüllt ist und in welchem
mittels Rührwerken die Wasserdämpfe in möglichst innige Berührung mit der Säure
gebracht und absorbirt werden. Die Kühlung der durch die Absorption sich erwärmenden
Säure erfolgt durch Wärmeabgabe an die Luft, zu welchem Zwecke der Mantel
wellenförmig gestaltet ist, und kann auſserdem durch Ueberrieselung mit kaltem
Wasser unterstützt werden. Zur erstmaligen Herstellung der Luftverdünnung und zur
Entfernung der im Wasser enthaltenen Luft dienen die Pumpen c und d. Erstere saugt die Luft an und
befördert dieselbe nach der kleineren Pumpe d, von
welcher die Luft ausgeworfen und auf atmosphärische Spannung gebracht wird. Ist in
dem Glascylinder A die erforderliche Luftleere
hergestellt, so läſst man durch den Hahn e langsam
Wasser zuflieſsen; ein Theil desselben verdampft alsdann und der Rest setzt sich als
Eis fest. Nach beendigter Eisbildung hat man nur das Ventil f zu schlieſsen und durch den Hahn e Luft
eintreten zu lassen, worauf der Eisblock durch Niederschrauben des Bodens entfernt
werden kann. Zum Eindampfen der verdünnten Säure dient ein kleiner Kochkessel g (Fig. 5) aus Hartblei,
welcher in einen etwas gröſseren kupfernen Kessel eingehängt ist; der Hohlraum
zwischen beiden Kesseln ist mit einer schwer siedenden Flüssigkeit gefüllt; diese
wird geheizt und überträgt die Wärme auf die Säure. Es ist diese Einrichtung
getroffen, um eine unnöthig starke Erhitzung der Säure zu vermeiden. Die Temperatur
der Heizflüssigkeit wird dadurch auf gleicher Höhe erhalten, daſs die bei zu starker
Erwärmung sich bildenden Dämpfe in einem kleinen Oberflächencondensator h gekühlt werden. Es soll mit dieser Maschine nach der
Versicherung der Erbauer möglich sein, in einem Zeiträume von etwa 15 Minuten 3 bis
4k Eis herzustellen, wobei natürlich
vorausgesetzt wird, daſs der Absorptionskessel mit concentrirter Säure beschickt
ist. Was dieser Art von Maschinen besonders zu statten kommt, ist der Umstand, daſs
dieselbe nur eine geringe mechanische Kraft zum Betriebe erfordert. Die an der Pumpe
zu leistende Arbeit beschränkt sich auf das erstmalige Herstellen der Luftleere und
die Entfernung der im Wasser enthaltenen Luft; der gröſste Theil der in Kälte
umgewandelten Arbeit wird geleistet von der Anziehungskraft zwischen der Säure und
dem Wasserdampfe bezieh. von der zur Eindampfung der Säure dienenden Gas- oder
Erdölfeuerung.
Von E. Fixary in Paris wird in neuerer Zeit eine auf dem
Prinzipe der Ammoniakcompression beruhende kleine
Eismaschine in Handel gebracht, welche stündlich nur 5k Eis erzeugt. Die Maschine besteht nach der dem Génie civil, 1886 Bd. 9 * S. 282 entnommenen Abbildung Fig. 6 Taf. 12 aus einem
mit dem Grundgestelle zusammengegossenen Behälter Z,
welcher als Condensator dient und in dessen unterstem Theile sich ein kleines
geschlossenes Gefäſs Y für das flüssige Ammoniak
befindet. Den oberen Theil des Gestelles bildet der Gefrierkasten X, in dessen Schlangenrohr das flüssige Ammoniak
verdampft, und daran angeschraubt die Compressionspumpe W. Der
Gefrierkasten ist mit Salzlösung gefüllt und trägt eine in Fig. 6 nicht sichtbare
Erweiterung, in welcher die mit Gefrierwasser gefüllten Zellen eingehängt sind. Die
Wirkungsweise der Maschine ist sehr einfach. Nachdem der Behälter Y mit der nöthigen Menge, etwa 2k, flüssigen Ammoniaks gefüllt worden, öffnet man
langsam das Regulirventil V und setzt gleichzeitig die
Pumpe W in Thätigkeit; hierdurch werden die in der
Spirale des Gefrierkastens entstehenden Dämpfe angesaugt und nach den Spiralen des
Condensators gedrückt, wo sie sich unter der Einwirkung des Kühlwassers verflüssigen
und wieder in den Behälter Y zurückflieſsen. Besondere
Sorgfalt ist auf eine ausreichende Schmierung des Kolbens und der Stopfbüchsen
verwendet. Zu diesem Zwecke ist neben dem Cylinder eine Kammer U angeordnet, welche mit Schmieröl gefüllt erhalten
wird. Der einfach wirkend angeordnete Kolben taucht mit seinem unteren Theile
vollständig in Oel und, da die Kammer U mit dem
Saugventile in Verbindung steht, so wird alles durch den Kolben entweichende
Ammoniak von der Pumpe wieder angesaugt. Das mitgerissene, in die
Condensatorspiralen gelangende Oel setzt sich schlieſslich im Behälter Y ab, wo es sich von dem specifisch leichteren Ammoniak
trennt, um von Zeit zu Zeit wieder nach der Schmierkammer U befördert zu werden. Die Maschine ist für Motorbetrieb eingerichtet, da
sie für Handbetrieb zu viel Kraft verbraucht. Es dürfte überhaupt schwer sein, die
Compressionsmaschinen, bei welchen die gesammte Kälteleistung nur durch mechanische
Arbeit zu erzielen ist, für Handbetrieb tauglich zu machen, da nicht nur die
schädlichen Widerstände im Verhältnisse zur Compressionsarbeit, sondern auch die
Ammoniakverluste durch die Stopfbüchse mit der Kleinheit der Maschine wachsen.
Tafeln