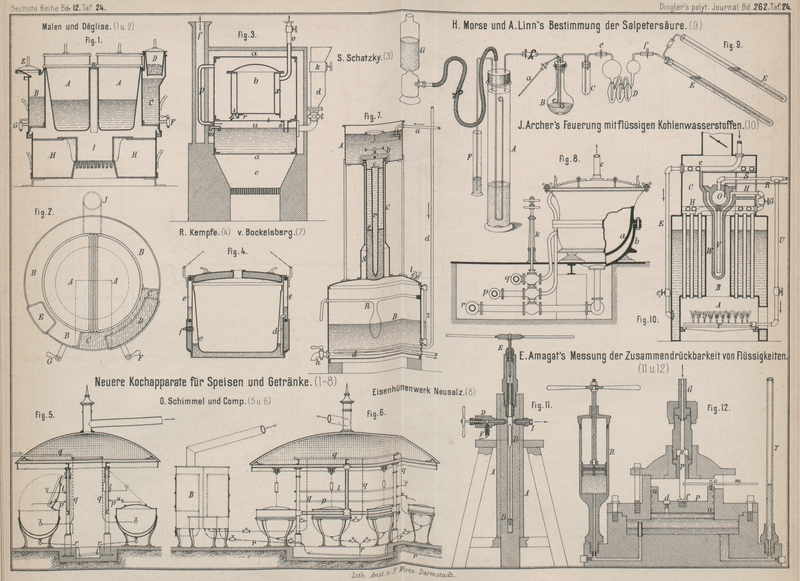| Titel: | Ueber Neuerungen an Kochapparaten für Speisen und Getränke. |
| Autor: | G. R. |
| Fundstelle: | Band 262, Jahrgang 1886, S. 366 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen an Kochapparaten für Speisen und
Getränke.
Patentklasse 34 und 36. Mit Abbildungen auf Tafel 24.
Neuerungen an Kochapparaten für Speisen und Getränke.
In dem nachfolgenden Berichte handelt es sich um Einrichtungen für Küchen von
Anstalten, wie Kasernen, Krankenhäuser, Gefängnisse u. dgl., in welchen also der
Speisenbedarf für eine gröſsere Anzahl von Personen zu decken ist. Ein
Unterscheidungsmerkmal für solche Kochapparate besteht in der Heizung; dieselbe
erfolgt entweder durch Unterfeuerung unmittelbar, oder unter Vermittelung eines
Wasser- oder DampfbadesVgl. Lentz 1882 246 *
374., oder auch durch Dampf von einem besonderen
Dampfkessel.Vgl. Becker 1883 248
460. 250 * 209. Grove 1883 250 * 209. Tietgé bez. Bechern 1885 255 * 514.
In kleineren Anstalten, wo durch das Erforderniſs eines geschulteren Heizers die
Anlage eines Dampfentwicklers oft auf Schwierigkeiten stöſst, kommen meist noch
Kochapparate mit Unterfeuerung zur Aufstellung, obwohl dieselben nicht minder eine
aufmerksame Beobachtung des Feuers verlangen. Für solche Anstalten erscheinen die in
der Kaserne der „Rue
de Chaligny“ in Paris von Malen und Déglise
aufgestellten Kochapparate beachtenswerth. Dieselben
sind freistehend, besitzen keinerlei die Wärme beim Anheizen zu stark aufnehmendes
Mauerwerk und vereinigen in geschickter Weise zwei Speisekessel, einen Warmwasserbehälter, einen besonderen Kaffeekochtopf und einen Bratraum in sich und
können dadurch auch Ansprüchen auf gleichzeitige Herstellung verschiedener Speisen
genügen, wie sie namentlich in Krankenhäusern gestellt werden. Fig. 1 und 2 Taf. 24 veranschaulichen
nach dem Génie civil, 1886 Bd. 8 * S. 375 die
Einrichtung eines solchen Kochapparates. Die Heizgase der Feuerung I bespülen unten und seitlich die zwei
halbkegelförmigen Speisekessel A, welche besonders
eingehängt werden, und einen diesen umschlieſsenden ringförmigen Behälter B von 1m,11 äuſseren
Durchmesser zur Erzeugung heiſsen Wassers. In den Behälter B, welcher durch den Deckel E gefüllt wird,
ist ein Theil C durch Zwischenwände abgetrennt; hier
wird das am Boden mit einem Siebe versehene Gefäſs D
mit gemahlenen Kaffeebohnen eingehängt und in dasselbe warmes Wasser aus B geschüttet, so daſs in C
der durch die Feuerung warm gehaltene Kaffee aufgefangen wird. Beide Kesselräume B und C sind mit
Ablaſshähnen G und F
versehen. Die die Feuerstelle I umhüllende Kammer H dient als Bratraum; bei J ist der Rauchabzug.
Bei dem Dampfkochapparate von S.
Schatzky in Moskau (* D. R. P. Kl. 36 Nr. 32 791 vom 14. März 1885) erfolgt
die Heizung des einen Speisegefäſses durch ein Dampfbad, welches in dem letzteres einhüllenden Gefäſse
durch unmittelbare Unterfeuerung erzeugt wird. Dabei
ist eine Einrichtung getroffen, daſs für das verdampfende Wasser ein
gleichbleibender Stand erzielt wird. Das in Fig. 3 Taf. 24 von den
Heizgasen der Feuerung c vollkommen umspülte und das
Speisegefäſs b aufnehmende Gefäſs a besitzt einen durch die Wand t abgetrennten Verdampfungsraum u, aus
welchem der Dampf durch das theilweise im Schornsteine f liegende Ueberhitzerrohr p zu dem Gefäſse
b gelangt; letzteres erhält einen Hohlmantel x, in welchen der Dampf durch einen nahe der Wand t mündenden Trichter r
eintritt, um bei o abzuziehen. Das Dampfwasser flieſst
durch einen Rohrstutzen s nach u zurück. Die Füllung des Raumes u erfolgt
durch einen Trichter d, welcher mit zwei Hähnen k und l versehen ist.
Einen zu hohen Wasserstand in u verhindert das
Ueberlaufrohr m; der auf diese Weise zulässige höchste
Wasserstand schneidet mit der höchsten Stelle der Mündung des Trichters d in u ab. Ist dieser
Wasserstand durch Eingieſsen in d erreicht, so wird der
Hahn k geschlossen, während l offen bleibt. Sinkt also durch Verdampfung der Wasserspiegel in u, so wird die Mündung von d frei und die entsprechende Menge Wasser wird aus d zugelassen.
Für solche Kochgefäſse, welche mit einem theilweise mit
Wasser gefüllten Mantel umgeben sind und in eine Feuerung eingehängt werden, so daſs das Wasser im Mantel in Dampf verwandelt wird, hat R. Kempfe in Magdeburg (* D. R. P. Kl. 34 Nr. 35304 vom
22. November 1885) eine Einrichtung angegeben, die ohne Sicherheits- und Luftventil
ein zu hohes Steigen der Dampfspannung selbst bei
stärkster Feuerung verhindern soll. Wie aus Fig. 4 Taf. 24
zu entnehmen ist, wird über den mit Wasser durch das verschlieſsbare Loch f theilweise gefüllten Hohlraum c noch ein ringförmiger, höher liegender Hohlraum e angeordnet und stehen diese beiden Räume durch ein beiderseits nahe am
Boden mündendes Röhrchen d in Verbindung. Beim Heizen
des Kochgefäſses wird durch den sich entwickelnden Dampf das Wasser aus c nach e gedrückt, so
daſs, wenn alles Wasser herüber befördert ist, in c
keine Dampfentwickelung mehr stattfindet, sondern der Dampf überhitzt wird. Mit der
Zunahme der Spannung des Dampfes tritt aber ein Theil desselben durch d nach e, wo sich derselbe
oben niederschlägt. Versuche sollen ergeben haben, daſs die Dampfspannung in c einen Ueberdruck von 0at,2 nicht überstiegen hat. Diese gleichmäſsige Wärme des Dampfbades ist
es, welche angestrebt wird, da bei diesen anhaltenden niedrigeren Temperaturen
hauptsächlich die Schmackhaftigkeit der Fleischspeisen erhalten bleibt (vgl. auch
1883 250 211).
Zur Herstellung gröſserer Kaffeemengen hat v. Bockelberg in Oldenburg (* D. R. P. Kl. 34 Nr. 30
599 vom 4. Juni 1884) einen sogen. Kaffeeaufguſsapparat
zur Ausführung gebracht, welcher namentlich eine billige Herstellung von gutem
Kaffeegetränk für Fabriken, Speisehäuser u. dgl.
ermöglicht. Der in Fig. 7 Taf. 24 veranschaulichte Apparat bedarf der Zuführung heiſsen
Wassers, welches von einem einfachen cylindrischen Wasserheizkessel geliefert wird,
in welchem durch Schwimmerventile ein gleichbleibender Wasserstand erreicht ist. Der
Aufguſsapparat wird etwa 2m,25 hoch ausgeführt und
setzt sich aus zwei Behältern B und A von 0m,94 bezieh.
0m,56 Durchmesser und 0m,7 bezieh. 0m,4
Höhe zusammen, welche durch ein 1m,15 langes und
0m,21 weites Rohr C verbunden sind. Der durch das Rohr a
erfolgende Zufluſs von heiſsem Wasser nach A wird durch
ein Schwimmerventil v selbstthätig geregelt. In das
Rohr C wird der oben umgebördelte und mit unterlegtem
Gummiringe versehene, unten geschlossene und dort und in einem Theile der Höhe
gelochte Cylinder S eingehängt und mittels aufgelegten
Kreuzes und Druckbügels b befestigt. Der Cylinder S wird mit etwa 5k
gemahlenen Kaffee beschickt und dann in denselben ein wieder im unteren Theile
gelochtes Trichterrohr r eingesetzt; das letztere wird
oben und kurz über dem Kaffee durch Siebringe bei e und
c gehalten. Das heiſse Wasser sinkt nun im Cylinder
S und Rohre r nieder,
durchdringt das Kaffeepulver, zieht dasselbe aus und sammelt sich im Behälter B, worin das fertige Getränk noch durch eine von dem
Wasserheizkessel gespeiste Dampfspirale d warm gehalten
werden kann. Ein Rührlöffel R in diesem Behälter dient
zur Mischung des nach und nach dünner aus S abflieſsenden
Kaffees. Ein Standrohr z läſst die Menge des
vorhandenen Getränkes erkennen, welches durch den Hahn h abgelassen wird; l ist ein Entlüftungshahn
für B. Bei diesem Apparate befördert hauptsächlich die
über dem Kaffeepulver stehende, 1m hohe
Wassersäule ein gutes Ausziehen des Kaffees, welches durch die radial aus dem Rohre
r gerichteten Flüssigkeitsstrahlen unterstützt
wird. Eine Cylinderfüllung von 5k ungebrannt
gewogenen Kaffees soll je nach der verlangten Güte in 1½ bis 2 Stunden 200 bis
500l Kaffeegetränk ergeben. Um einen
ununterbrochenen Betrieb zu ermöglichen, werden gewöhnlich zwei der beschriebenen
Apparate, welche von einem Wasserheizkessel gleichzeitig bedient werden, angewendet.
Eine solche Anlage kostet 1000 M.
Nach der Zeitschrift des Ingenieur- und Architekten-Vereins
für Hannover, 1886 S. 186 ergibt sich bei einer solchen Anlage zur
täglichen Lieferung von 600l besseren Kaffees aus
15k ungebrannten Bohnen folgende
Kostenberechnung:
15k Kaffeebohnen, 1k zu 1,40 M
21,00 M.
50k Steinkohlen und Torf
zum Brennen des Kaffees und zur Heiſswasserbereitung
1,50
Verzinsung und Tilgung, sowie Ausbesserungskosten, zu
36 % jährlich vom Anlagekapitale, rund
1,00
–––––––
Zusammen
23,50 M.
oder 24 M., so daſs 1l
Kaffee auf 2400 : 600 = 4 Pf. zu stehen kommt; schwächerer Kaffee, z.B. 1500l aus demselben Bohnengewichte, stellt sich für
1l auf nur 1,6 Pf.
In gröſseren Anstalten wird man zur Speiseversorgung immer zur Anlage von
Dampfkochapparaten greifen, wo also alle Gefäſse durch
einem gemeinschaftlichen Dampfkessel entnommenen Dampf
geheizt werden. Es ist hierfür namentlich die dabei in leichtester und
schnellster Weise zu bewirkende Regelung der Wärmezufuhr, die ermöglichte groſse
Reinlichkeit des Küchenraumes und die leichte Bedienung der Apparate maſsgebend. Je
nach der Art der Anstalt ist die Aufstellung weniger Gefäſse von gröſserem Inhalte
oder mehrerer kleinerer Gefäſse nothwendig. Die letztere Rücksicht ist bei
Krankenhäusern zu nehmen, da in denselben stets eine gröſsere Anzahl von Speisen auf
einmal zuzubereiten ist, welche auch eine sehr verschiedene Temperatur zu ihrer
Herstellung benöthigen.
Während die Kochgefäſse vorwiegend aus innen verzinntem
Kupferblech hergestellt werden, fertigt dieselben das Eisenhütten-Emaillirwerk in Neusalz a. W. nach dem Praktischen Maschinen-Constructeur, 1884 * S. 305 aus Guſseisen. Dafür soll die fast unbeschränkte Dauerhaftigkeit und die
geringe Abnutzung durch das Reinigen maſsgebend sein. Die Herstellungskosten sind
allerdings gegenüber Kupferkesseln nicht geringer; es können also dafür bloſs die
genannten Gründe und die gröſsere Standfestigkeit gegen Anstoſs harter Gegenstände,
wobei das Kupferblech leicht Beulen erhält, sprechen. In Fig. 8 Taf. 24 ist die
Anlage solcher guſseiserner Kochkessel, wie dieselbe in der Strafanstalt zu Jauer in
Schlesien getroffen wurde, dargestellt. Die Kessel haben nicht die gebräuchlichere
Halbkugelform, sondern sind etwas tiefer und innen und auſsen blank abgedreht; roh
sind nur die Innenflächen des Dampfmantels, welcher durch die Verschraubung des
Kessels a mit der Bodenschale b gebildet wird, auf deren vier kurzen Füſsen der ganze Kochapparat ruht.
Die Kochkessel (6 an der Zahl mit 500, 250 und 60l
Inhalt) sind in einer Reihe aufgestellt und entsprechend liegen zur Seite dieser
Reihe in einem abgedeckten Bodenkanale die Röhren q und
p bezieh. r für Dampf-
und Kaltwasserzuleitung bezieh. für die Dampfwasserableitung. Die Zu- und
Ableitungen sind durch Ventile von k aus zu regeln. Die
Deckel d der Kessel sind dreitheilig, so daſs zwei
aufklappbare Theile erhalten werden, während der mittlere Theil ein Dunstabzugsrohr
c trägt; letzteres dürfte sich jedoch der
Schmackhafthaltung der Speisen wegen nicht immer empfehlen.
Eine von dieser Anlage etwas abweichende Einrichtung der Kochküche haben O. Schimmel und Comp. in
Chemnitz in letzterer Zeit in den Universitätskliniken zu Budapest ausgeführt. Die
Kochkessel sind dabei in zwei parallelen Reihen angeordnet, wie sich diese Anordnung
auch im Barackenlazareth in Moabit-Berlin u.a. O. findet, und in Halbkugelform in
innen stark verzinntem Kupferbleche ausgeführt. Es sind 8 Kochkessel von 600 bis
herab zu 100l Inhalt vorhanden, entsprechend einer
Speisung von etwa 300 Personen. Die Kessel ruhen, wie in Fig. 5 und 6 ersichtlich gemacht ist,
frei in dreibeinigen Gestellen, so daſs alle Zuleitungs- und Ableitungsrohre
sichtbar sind und Undichtheiten gleich bemerkt werden. Oberhalb der Kochkessel ruht
auf 4 innerhalb des Kesselkranzes stehenden Säulen ein Wellblechdach, welches den
aufsteigenden Dunst zu fangen und durch ein Rohr nach einem Abzugsschlote abzuleiten
hat. Das Dachgestelle trägt gleichzeitig die Rollen für die Gegengewichtketten der
aufklappbaren Kesseldeckel und auch die Leitungsrohre q,
p und l für Dampf, Wasser und Leuchtgas. Das
Wasserrohr p hat für je 2 Kessel einen drehbaren
Ausfluſsarm. Die Ableitungen r für das Dampfwasser
führen in ein gemeinschaftliches Abfluſsrohr, welches in einer Grube innerhalb der
Kessel liegt. Neben den Kochkesseln ist der für ein Krankenhaus kaum entbehrliche,
mit gewöhnlicher Feuerung zu heizende Bratofen B
aufgestellt; derselbe enthält auch eine Kammer zur Anwärmung von Speisegeschirr,
welche durch mit Dampf gespeiste Rippenheizkörper erwärmt wird.
G. R.
Tafeln