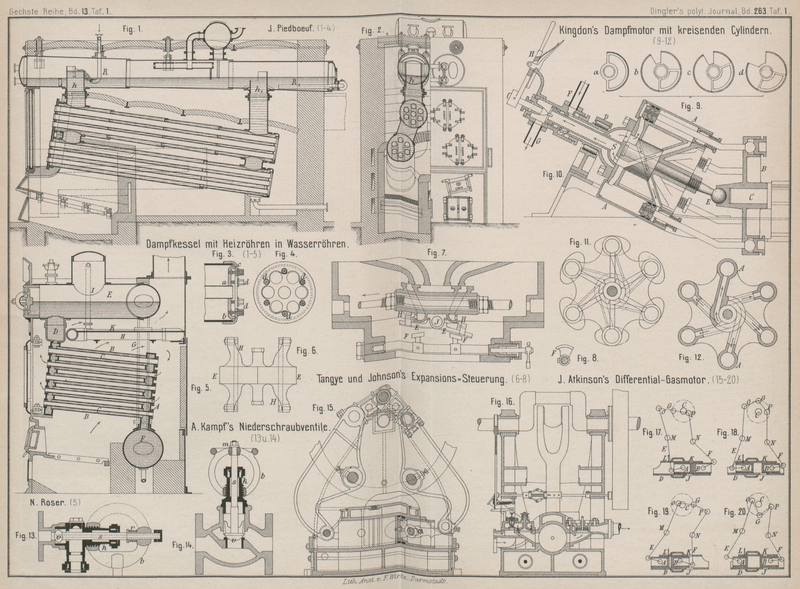| Titel: | Dampfkessel mit von Heizröhren durchzogenen Wasserröhren. |
| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 10 |
| Download: | XML |
Dampfkessel mit von Heizröhren durchzogenen
Wasserröhren.
Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 1.
Dampfkessel mit Heizröhren in Wasserröhren.
Die bereits verschiedentlich bei Dampferzeugern getroffene Anordnung von Heizröhren,
welche durch Wasserröhren gehen (vgl. Maschinenfabrik
Buckau u.a. 1885 258 * 298), hat J. L Piedboeuf in Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 36063 vom
17. Januar 1886) in einer neuen Weise benutzt. Der in Vorschlag gebrachte Kessel
setzt sich aus einer Anzahl mit einander verbundener, schräg liegender, weiter Rohre
– bei dem in Fig.
1 und 2 Taf. 1 abgebildeten Kessel z.B. 6 – zusammen, welche zu je drei derart
unter einander liegen, daſs die obersten nahezu wagerechten Rohre, die noch durch
einen besonderen quer liegenden Dampfsammler mit einander verbunden sind, den
Dampfraum bilden, während die unteren, kürzeren und geneigten Rohre als eigentliche
Siederohre der Hauptsache nach zur Dampferzeugung dienen. Jeder dieser Sieder ist aber noch der Länge nach von einem Bündel Heizröhren durchzogen – im vorliegenden
Falle je 7 –, welches im Ganzen aus dem Sieder herausgezogen werden kann. Zu diesem Zwecke ist die vordere Rohrwand
einfach auf die abgedrehte Winkelflansche des Sieders geschraubt, während die
hintere Röhrenwand a, wie in Fig. 3 und 4 Taf. 1 besonders
veranschaulicht ist, sich mit einem an ihre Krempe b
angedrehten dünnen Ringe in die eingedrehte, metallisch gedichtete Nuth des
Bodenkranzes c legt und mittels starker Schrauben d dicht angezogen wird. Die beiden nach innen und
hinten geneigten Roste liegen unter dem Kessel und werden durch eine feuerfeste
Mittelwand von einander getrennt. Die Feuergase, welche sich hinter dem Roste in
einer engen, gemeinschaftlichen Durchgangsöffnung mischen, bestreichen zunächst die
äuſsere Mantelfläche der Sieder, durchziehen dann, zurückkehrend, die Heizröhren in denselben und nehmen
hierauf, den Oberkessel umspülend, ihren Weg zum Schornstein.
Der vordere Verbindungsstutzen h (Fig. 1) bildet mit seiner
etwa 150mm über den niedrigsten Wasserspiegel
reichenden Verlängerung ein Ueberlaufrohr für das mit lebhafter Bewegung aus den
Siedern in den Oberkessel steigende Gemisch von Wasser und Dampf. In Folge des
Ueberfallens dieses Gemisches soll sich der Dampf vom Wasser scheiden: auch die
durch die heftige Strömung mitgeführten Kesselsteinabsonderungen lagern sich auf dem
Boden des leicht zugänglichen Oberkessels ab, da ein Mitschleppen derselben wieder
in die Sieder hinunter durch die bis etwa 100mm
unter den niedrigsten Wasserspiegel reichende Verlängerung des hinteren Stutzens h1 verhindert wird. Das
heiſse Wasser begegnet beim Ueberfallen aus dem Stutzen h dem frischen kälteren, durch das Rohr R
eingeführten Speisewasser, wodurch dieses zerstäubt wird und gleichzeitig in Folge
der plötzlichen Temperaturerhöhung seine festen Bestandtheile in Schlammform im
Oberkessel absetzen soll. Zum Abblasen des Schlammes dient das am hinteren Ende des
Oberkessels angebrachte Rohr R1.
Ein von N. Roser in Frankreich patentirter und auf dem
„Concours général agricole“ in Paris
1886 im Betriebe vorgeführter Kessel hat nach der Revue
industrielle, 1886 * S. 161 wieder in jedem Wasserrohre ein concentrisches
Heizrohr. Wie aus Fig. 5 Taf. 1 zu entnehmen, ist dieser Wasserröhrenkessel von der als explosionssicher bezeichneten Art, dessen
Rohre in senkrechten Reihen durch je zwei Endkammern A
verbunden sind und zwar mit dem Oberkessel E und dem
Unterkessel F, welche beide auch noch durch ein
senkrechtes Rohr G zur Herstellung eines richtigen
Wasserumlaufes mit einander in Verbindung stehen. In die sonst bei
Wasserröhrenkesseln den Rohren gegenüber stehenden Verschluſsdeckel hat Roser je ein Heizrohr C
eingesetzt, welches durch das Wasserrohr B
hindurchgeht. Die von dem Roste aufsteigenden Feuergase umspülen zuerst die
Wasserrohre von auſsen, ziehen dann über denselben nach hinten und gehen nun durch
die Rauchrohre nach vorn, worauf sie unter dem Oberkessel E weg nach dem Schornsteine entweichen. Die Röhren H, welche in die wagerechte Trennungswand K
des Feuerzuges zwischen Oberkessel und Röhrensystem eingelagert sind, dienen als
Ueberhitzer bezieh. zum Trocknen des Dampfes, welcher den Röhren H durch ein Rohr I aus dem
Dampfdome zugeführt wird.
Nachstehend sind noch die Ergebnisse zweier in den Werkstätten des Erbauers mit einem
solchen Kessel angestellter Versuche mitgetheilt. Jeder derselben dauerte im Mittel
9½ Stunden und der Dampfdruck wechselte beim ersten Versuche zwischen 6 und 7at, beim zweiten zwischen 5 und 7at; am Schlusse der Versuche betrug derselbe 7at. Der mittlere Wasserspiegel fiel mit der Achse
des Oberkessels zusammen. Die gesammte Heizfläche betrug 41qm, von welchen 38 auf die Röhren kommen; der gesammte Kessel nimmt
einen Raum von 2m,70 × 2m bei 3m,455
Höhe ein. Bei der Verdampfungsprobe erhielt man mit Staubkohle 15 bis 15k,45 Dampf für Stunde und 1qm Heizfläche. Auf 1k Brennmaterial bezogen, betrug die Verdampfung 9,23 bis 9k,69, also eine sehr beträchtliche Leistung. Wenn
diese Ergebnisse sich im laufenden Betriebe ebenfalls erzielen lassen, so dürfte der
Roser'sche Kessel wohl als vortheilhaft angesehen
werden.
Tafeln