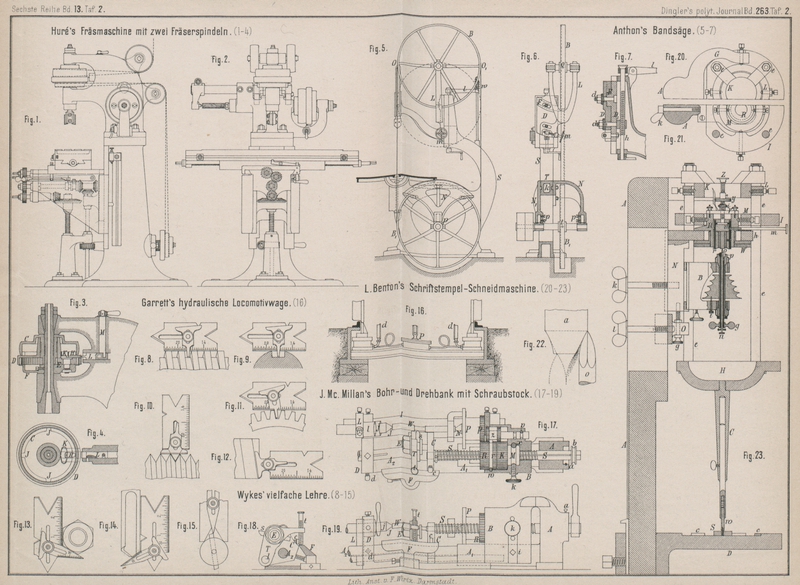| Titel: | P. Huré's Fräsmaschine mit zwei senkrecht zu einander stehenden Fräserspindeln. |
| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 16 |
| Download: | XML |
P. Huré's Fräsmaschine mit zwei senkrecht zu
einander stehenden Fräserspindeln.
Mit Abbildungen auf Tafel
2.
Huré's Fräsmaschine mit zwei Fraserspindeln.
Für allgemeine Fräsarbeiten bringt P. Huré in Paris die
in Fig. 1 und
2 Taf. 2
nach dem Génie civil, 1886 Bd. 9 * S. 166 dargestellte
Maschine zur Ausführung, welche eine wagerecht und eine lothrecht gelagerte
Fräserspindel besitzt. Je nach Bedarf wird nun entweder die liegende oder die
stehende Fräse zum Angriffe an das Werkstück gebracht und dazu der obere Lagerkörper
auf dem Fuſsgestelle je um 90° gedreht, so daſs die eine Fräse über den verstell
baren Werkzeugträger zu stehen kommt. Der Antrieb der Fräserspindeln erfolgt durch
Riemen und zwar wird die wagerechte Spindel unmittelbar, die stehende aber durch
Vermittelung von zwei Leitrollen angetrieben. Dadurch muſs allerdings, wenn nur ein
Antriebsriemen vorhanden ist, derselbe im ersten Falle verkürzt, wie auch der Riemen
für die Ableitung der Schaltbewegung ausgewechselt werden. Weil bei dieser Anordnung
des Riementriebes Stufenscheiben ausgeschlossen erscheinen, so sind für die Drehung
der Fräserspindeln bloſs zwei Geschwindigkeiten eingerichtet, von welchen jene für
den langsamen Gang durch die Anordnung eines Differentialvorgeleges bemerkenswerth erscheint.
Wie in Fig. 3
und 4 Taf. 2
besonders ersichtlich gemacht ist, läuft die Nabe der Antriebscheibe C in ein Getriebe aus, welches in ein Zwischenrad E greift, dessen Drehzapfen in eine auf der
Fräserspindel befestigten Scheibe F sitzt. Dieses
Zwischenrad E steht gleichzeitig mit dem innen
verzahnten Rade D in Eingriff, welches sich frei um die
Nabe von C dreht. Auf dem vollen Boden des Rades D führt sich ein Sperrriegel H (vgl. Fig. 4), welcher durch eine Feder K nach
auſsen geschoben wird, so daſs der Riegel H in einem
der vier in dem Rande der Scheibe C vorhandenen
Ausschnitte J einklinkt und dadurch die Scheibe C mit dem Rade D kuppelt,
so daſs dann die Fräserspindel dieselbe Zahl Umdrehungen wie die Riemenscheibe C macht. Drückt man den Sperrriegel H zurück, so wird die Zapfenscheibe F und mit dieser die Fräserspindel [r × n : (r + R)] Umdrehungen
machen, sofern r und R die
Halbmesser des Getriebes an der Scheibe C und des Rades
D sowie n die
Umlaufzahl der Scheibe C bedeuten. Der Riegel H wird durch einen Druckstift L nach innen geschoben, welcher mittels einer kleinen Handkurbel M bewegt wird.
Die Tischbewegungen sind selbstthätig, auch in der Lothrechten. Die Umkehrung und
Abstellung des Selbstganges erfolgt durch Verschiebung eines Muffes mit gegenüber
stehenden Winkelrädern, welche abwechselnd in ein dazwischen liegendes gleiches Rad
greifen, das auf einer stehenden, durch Schneckengetriebe bewegten Achse sitzt. Auch
ist noch eine selbstthätige Ausrückung der Schaltung vorgesehen, indem Hubklötzchen einen Winkelhebel
drehen, wodurch eine Klinke ausgehoben und dadurch ein Querhebel frei wird, welcher
den Kuppelmuff zwischen dem Winkelräderpaare verschiebt. (Vgl. Uebersicht 1886 261 * 286.)
Tafeln