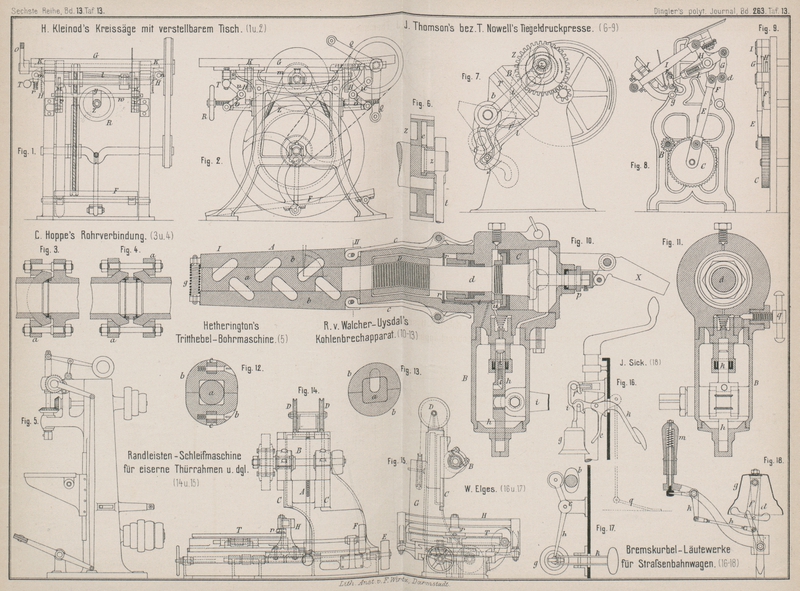| Titel: | Rudolf Ritter v. Walcher-Uysdal's Kohlenbrechapparat. |
| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 227 |
| Download: | XML |
Rudolf Ritter v. Walcher-Uysdal's Kohlenbrechapparat.
Mit Abbildungen auf Tafel
13.
Walcher-Uysdal's Kohlenbrechapparat.
Ein von Rudolf Ritter v. Walcher-Uysdal in Teschen (vgl.
* D. R. P. Kl. 5 Nr. 37715 vom 8. Januar 1886) angegebener Kohlenbrechapparat,
welchen Bergdirector E. v. Wurzian in der Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und
Hüttenwesen, 1886 * S. 283 beschreibt, verdient als ein neuer Versuch, die
Schieſsarbeit in Steinkohlengruben zu ersetzen, Beachtung. Der Apparat erinnert in
seiner äuſseren Form sowohl, wie auch in der Anordnung der Haupttheile an den Levet'schen Keil (vgl. 1882 246 * 18). Wegen des verhältniſsmäſsig geringen Gewichtes von 92k kann der neue Apparat bequem von zwei Mann
gehandhabt werden und überall an Stelle der Schieſsarbeit zur Verwendung gelangen,
vor welcher er auſser der gänzlichen Ungefährlichkeit Schlagwettern und Kohlenstaub
gegenüber noch den Vortheil eines reichlicheren Stückkohlenfalles bietet. Die
Bohrlöcher für die Einführung des Kohlenbrechers werden in der Kohle 1m tief und 117mm
weit mittels eines verstärkten Lisbeth'schen
Schneckenbohrers mit einfachem Bohrständer in etwa 10 Minuten hergestellt.
Der in Fig. 10
bis 13 Taf.
13 gezeichnete Kohlenbrechapparat besteht, wie aus dem Längsschnitte Fig. 10 ersichtlich ist,
aus den in passender Form vereinigten drei Haupttheilen, dem eigentlichen Brecher
il, der in das Bohrloch eingeführt wird, dem Preſscylinder und der Druckpumpe B. Letztere ist am zweckmäſsigsten mit Glycerin zu
füllen und so eingerichtet, daſs mit derselben ein Druck von 500at ausgeübt werden kann. Der Brecher hat, wie aus
den Schnitten Fig.
12 und 13 hervorgeht, vorn einen kreisrunden, im hinteren Theile einen
ellipsenförmigen Querschnitt und besteht aus den beiden Backen b und dem Mittelstücke a.
Die Brechbacken b werden an ihrem vorderen Theile durch
die Spiralfeder g, hinten durch die Federn c zusammengehalten. Diese Theile sind zur Aufnahme von
sechs Stelzen, welche in der Ruhelage mit der Achse des Apparates einen Winkel von
45° einschlieſsen, entsprechend ausgefräst und aus Guſsstahl hergestellt.
Preſscylinder und Druckpumpe sind aus bester Bronze gefertigt. Der Kolben h der Druckpumpe wird in üblicher Weise durch den Hebel
i auf- und niederbewegt, drückt das Glycerin vor
den Preſskolben C und zieht dadurch das Mittelstück a zurück, wodurch die Stelzen allmählich bis zu einem
Winkel von 85° aufgerichtet werden. Hierdurch wird mittels der Brechbacken b ein sich stetig steigernder Druck auf die
Bohrlochwände ausgeübt, welcher gleich dem wagerechten Zuge des Stückes a mal der Tangente des Winkels ist, den die Stelzen mit
der Kolbenachse einschlieſsen. Der Preſskolben macht hierbei einen Weg von 32mm und die Brechbacken b öffnen sich um 30mm. Die
Reibungswiderstände bei dieser Arbeit sind sehr geringe. Die Kolbenstange d ist rückwärts durch die Stopfbüchse p verlängert, wodurch der Stand des Preſskolbens C und der Stelzen ersichtlich wird. Sollte jedoch durch
Unachtsamkeit eines Arbeiters trotzdem nach vollendetem Kolbenwege weitergepumpt
werden, so trifft der Verbindungsmuff D auf einen losen
Ring r, durch welchen mittels der Führungsstange t das Ventil u gehoben und
dadurch der Druck vom Kolben C fortgenommen wird. Falls
hierauf die Stelzen nicht selbstthätig niederfallen, kann der Preſskolben C mit Hilfe des Hebels X
vorgeschoben werden. Endlich ist auch noch eine Preſsschraube q (Fig. 11) vorhanden,
welche dazu dient, um zu irgend welcher Zeit den Preſskolben vom Drucke zu
entlasten.
Zahlreiche mit dem beschriebenen Apparate auf der Gabrielen-Zeche in Karwin,
Oestr.-Schlesien, ausgeführte Versuche sollen seine Brauchbarkeit bewiesen haben.
Diese Versuche wurden mit gleich gutem Erfolge beim Ortsbetriebe und beim
Pfeilerabbaue zum Abbänken unterschrämter, z. Th. noch auſserdem an einem Stoſse
geschlitzter Kohle durchgeführt. Auch in mehreren Gruben des rheinisch-westfälischen
Kohlenbezirkes sind mit dem Walcher'schen Kohlenbrecher
Versuche gemacht worden, über welche Bergrath Schrader
im Glückauf, 1886 Nr. 67 Näheres mittheilt; hiernach
soll der Apparat zum Abbaue in Flötzen mit guten Schrambänken wohl geeignet sein,
dagegen nicht bei fester Kohle und besonders bei fehlendem Schräm. Für Deutschland
hat die Ausführung des Apparates die Märkische
Maschinenbauanstalt vormals Kamp und Comp. in Wetter a. d. Ruhr
übernommen.
Tafeln