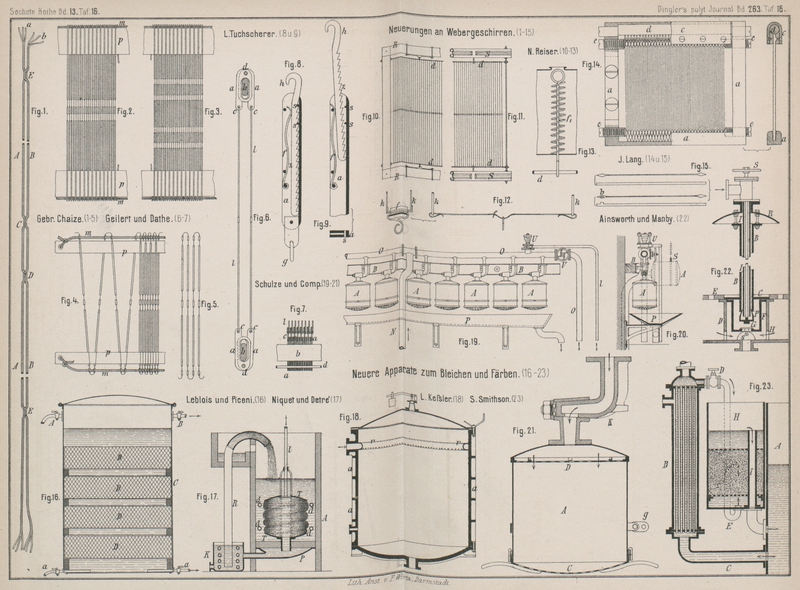| Titel: | Ueber Neuerungen an Apparaten zum Färben und Bleichen von Gespinnstfasern. |
| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 273 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen an Apparaten zum Färben und
Bleichen von Gespinnstfasern.
(Patentklasse 8. Fortsetzung des Berichtes Bd. 257
S. 319.)Vgl. auch Obermaier's Schleuderapparat 1886 259 * 18. Mather's
Beuchkessel 1886 261 119. 262 * 221.
Mit Abbildungen auf Tafel
16.
Neuerungen an Apparaten zum Färben und Bleichen.
Die nachfolgend zur Besprechung gelangenden Apparate dienen zur Behandlung von
Gespinnstfasern im Allgemeinen; es ist also bei denselben gleichgültige ob die letzteren
in loser Form als Vorgespinnst, als Garn in Strähnen oder als GewebeIn Bezug auf Farbe- und Bleichapparate für Strahngarn und Gewebe sei auf die
Berichte 1886 259 * 78 bezieh. 261 * 119 verwiesen. zu färben, zu
bleichen oder auszuwaschen sind. Der hierbei schon so verschiedentlich benutzte Kreislauf der Färbe- und Bleichflüssigkeit bei
festliegendem Faserstoff welche Einrichtungen sich bewährt haben und in neuerer Zeit
allgemeinere Anwendung erfahren, findet sich auch wieder bei einigen neueren
Apparaten vor.
Schulze und Comp. in Schmölln, Sachsen-Altenburg (* D.
R. P. Nr. 36981 vom 9. März 1886) benutzen zur Aufnahme der Faserstoffe hängende, unten durch einen
Siebboden geschlossene Gefäſse, durch welche von oben die Färbeflüssigkeit
mit Hilfe einer Druckpumpe getrieben wird. Die hängende
Anordnung der Gefäſse ist zur leichteren Bedienung einer ganzen Reihe derselben
getroffen. Die einzelnen Gefäſse A hängen, wie aus Fig. 19 und
20 Taf.
16 zu ersehen ist, an Rohrkrümmern, die an einem Träger B befestigt und mit einem Rohre O verbunden
sind, in welches das Druckrohr N einer Kapsel werkpumpe
mündet. Die wagerechten Seiten der Rohrkrümmer K (Fig. 21 Taf.
16) sind kegelförmig und so eingerichtet, daſs bei dem Hochheben eines Gefäſses in
wagerechte Lage, wie in Fig. 20 punktirt
angedeutet ist, ein Abschluſs des Einlaufstutzens des Gefäſses erfolgt, also der
weitere Eintritt von Färbeflüssigkeit in dasselbe aufgehoben wird. In der
wagerechten Lage ist das Gefäſs dann auch nach Abnahme des bloſs mittels
Bajonettverschluſs befestigten Siebbodens C leicht zu
entleeren und mit Faserstoffen zu verpacken, weshalb die Gefäſse in dieser Lage
durch Einhängen des Auges g an Ketten S festgehalten werden können. Die von oben in die
Gefäſse A eingedrückte Flüssigkeit wird durch die
zwischen der Siebeinlage D und dem Siebboden B befindlichen Faserstoffe gepreſst und von einer Rinne
P aufgefangen, welche die Flüssigkeit nach einem
Behälter leitet, woraus die das Rohr O speisende Pumpe
saugt.
Man kann während des Flüssigkeitsumlaufes jedes Gefäſs unabhängig von den anderen
beschicken und entleeren. Damit bei Ausschaltung mehrerer Gefäſse der
Flüssigkeitsdruck nicht zu hoch steigt, ist in dem Rohre O ein Sicherheitsventil V mit einer
besonderen Leitung l nach dem Flüssigkeitsbehälter
angeordnet. Das Rohr O selbst reicht bis in den
letzteren Behälter, um bei sämmtlich ausgeschalteten Gefäſsen nach Oeffnung des
Ventiles V den Flüssigkeitsstrom dorthin zu leiten.
Niquet und Detré bewirken
nach ihrem französischen Patente einen Kreislauf der Flüssigkeit durch die zu
behandelnden Faserstoffe bei zusammengepreſster Lage derselben., indem zu Anfang die Luft aus dem Faserballen abgesaugt wird, die äuſsere Luft also die Flüssigkeit
in den Ballen drückt. Um dann eine beständige Strömung
zu erhalten, wird die
aus dem Inneren des Ballens durch ein Rohr ablaufende Flüssigkeit abgekühlt, so daſs durch den Wärmeunterschied ein Nachfolgen
der wärmeren Flüssigkeit stattfindet.
Die zu färbenden Faserstoffe werden in dem Bottiche A (Fig. 17 Taf. 16) zwischen
den beiden Tellern T zusammengepreſst erhalten. Der
untere feste Teller steht durch einen kurzen Rohransatz mit der
Flüssigkeitsfangschale P in Verbindung und der obere in
einem Rahmen niederer zu stellende Teller besitzt eine mittlere Einsatzöffnung, an
welche sich das zu einer Luftpumpe führende Rohr l
anschlieſst. Nach dem Einbringen der Faserstoffe wird die Färbeflüssigkeit in den
Bottich A gelassen und darin durch Dampfröhren d auf einer bestimmten Temperatur erhalten. Oeffnet man
nun das Rohr l, während die Luftpumpe arbeitet, so wird
die Flüssigkeit von allen Seiten durch den Faserballen nach der Mitte zu gedrückt;
dort soll sich dieselbe in der Schale P sammeln und
nach dem Röhrenkühler K ablaufen. Die Luftpumpe ist
hierbei abgestellt und es soll nun ein beständiges Durchdringen des Ballens mit der
Flüssigkeit stattfinden; letztere wird aus dem Kühler K
durch einen Dampfstrahlapparat im Rohre R wieder in den
Bottich A zurück befördert.
Die durch Wärmeunterschiede in einer Flüssigkeitsleitung
hervorgebrachte Strömung in derselben benutzt S. Smithson in Ravensthorpe, England (* D. R. P. Nr.
38225 vom 27. Mai 1886), um die Sättigung der
Färbeflüssigkeit stets gleich zu erhalten. Die
in dem Bottiche A (Fig. 23 Taf. 16)
befindliche Flüssigkeit gibt an die Faserstoffe Farbe ab und wird dadurch an
Farbstoff ärmer. Aus dem Bottiche A führt ein Rohr C nach dem Röhrenvorwärmer B, und indem die Färbeflüssigkeit in diesen gelangt, erwärmt sie sich,
steigt empor, um dann oben durch das Ventil D
abzulaufen und durch das Rohr E von unten in den
Behälter H einzutreten. In diesem befinden sich
zwischen Sieben eingebettet Farbholzspäne F, welche die
Flüssigkeit von unten nach oben durchstreichen muſs; dabei sättigt sich dieselbe
wieder mit Farbstoff und diese gelangt hierauf durch das Ueberlaufrohr I zu neuer Farbstoffabgabe in den Bottich A zurück.
Gewöhnlich werden zwei Farbholzbehälter H angeordnet, um
immer den einen zu benutzen, während der andere entleert, gereinigt und frisch
beschickt wird. Entsprechend erhält dann auch das Ablaufrohr des Vorwärmers zwei
Ventile D mit Rohren E.
Für Beuchkessel mit sogen. Ueberguſsapparat haben R. Ainsworth und E. Manby in Bolton (Englisches Patent
1885 Nr. 19) eine Anordnung des Ueberguſsrohres mit centraler Dampf Zuführung zur Hervorbringung des Flüssigkeitsumlaufes
getroffen. In Fig.
22 Taf. 16 ist dieser neue Theil des Beuchkessels für sich gezeichnet. Der
falsche Siebboden E desselben wird in der Mitte des
Kessels von einem Kasten D gestützt, dessen Wände unten
Einlauföffnungen H für die Flüssigkeit haben. Auf
diesem Kasten D ist die Flansche C des Ueberguſsrohres B
befestigt und unter diesem ein zweiter Kasten F, der
von unten durch ein nach innen sich öffnendes Ventil G
für die Flüssigkeit zugänglich ist. Die Bewegung des Ventiles G wird durch einen Schraubenkopf s begrenzt. Innerhalb des Rohres B steckt das Dampfzuführungsrohr I, über dessen unteres Ende die Kapsel P greift, welche gleichzeitig zum Verschlüsse des
Ringraumes zwischen den Rohren B und I dient und mittels des Handrades S von auſsen stellbar ist. Bei Oeffnung des Ventiles
P und bei Dampfzuleitung im Rohre I steigt der Dampf in dem Rohre B empor und reiſst die in den Kasten F
eingetretene Flüssigkeit mit, welche oben an den Schirm R trifft und dadurch als Sprühregen sich über die im Kessel liegenden
Faserstoffe ergieſst. Die Flüssigkeit sickert durch dieselben und tritt dann von
Neuem in den Kasten F. Wird die Kapsel P so weit niedergeschraubt, daſs dieselbe das Ventil
G geschlossen hält, so kann Flüssigkeit nicht mehr
übergegossen werden und die Faserstoffe werden dann nur der Dampfwirkung
ausgesetzt.
Zur Vorbereitung von Baumwolle für das Bleichen benutzen
Leblois, Piceni und Comp. in St.
Aubin-Jouxte-Bulleng, Frankreich (* D. R. P. Nr. 36962 vom 8. December 1885) den in
Fig. 16
Taf. 16 dargestellten Apparat. Die vorher gekrempelte Baumwolle wird in loser Form
oder als Band in Gitterkasten D gelegt und diese durch
Holzrahmen von einander getrennt in den Bottich C
gestellt. Der Hahn A desselben dient zum Lufteinlasse,
der Hahn B zur Verbindung mit einem Luftsauger; a, a sind Ablaſshähne. Der gefüllte Bottich wird mit
einer Flüssigkeit, am besten destillirtem Wasser mit einem Zusätze von 1k Panamaseifenrinde (Quillaja saponaria) und 0k,5 Oxalsäure
auf 100l Wasser, beschickt, worauf der Bottich
luftdicht verschlossen und durch Luftabsaugung ein vollkommenes Durchtränken der
Fasern erzielt wird.
Die beim Bleichen benutzten sogen. Vacuumapparate,
welche des Angriffes der Säuren wegen aus innen verbleitem Guſseisen hergestellt
werden, leiden auch an dem Uebelstande der geringen Haltbarkeit des Bleiüberzuges;
deshalb schlagen L. Keſsler und Sohn in Bernburg a. S.
(* D. R. P. Nr. 37413 vom 2. März 1886) die Anwendung ganz
aus Blei hergestellter Kessel vor.Für Sulfitstoffkocher hat Routledge (vgl. 1885
258 318) bereits einen solchen Vorschlag
gemacht.
Fig. 18 Taf.
16 veranschaulicht einen solchen Apparat; der Boden und Mantel desselben sind stark
aus Blei gegossen und der letztere zur Verstärkung mit Rippen a versehen. An dem Mantel ist auch gleich das unten
gelochte Rohr r zur Einführung und zum Uebergieſsen der
Flüssigkeit angegossen. Für den Guſs des Bleimantels wird für dieses Rohr ein mit
Kochsalz festgestampfter Kern aus dünnem Zinkblech in die Form eingelegt und dieser
Kern nach dem Gusse durch warmes Wasser ausgelaugt.
G. Rohn.
Tafeln