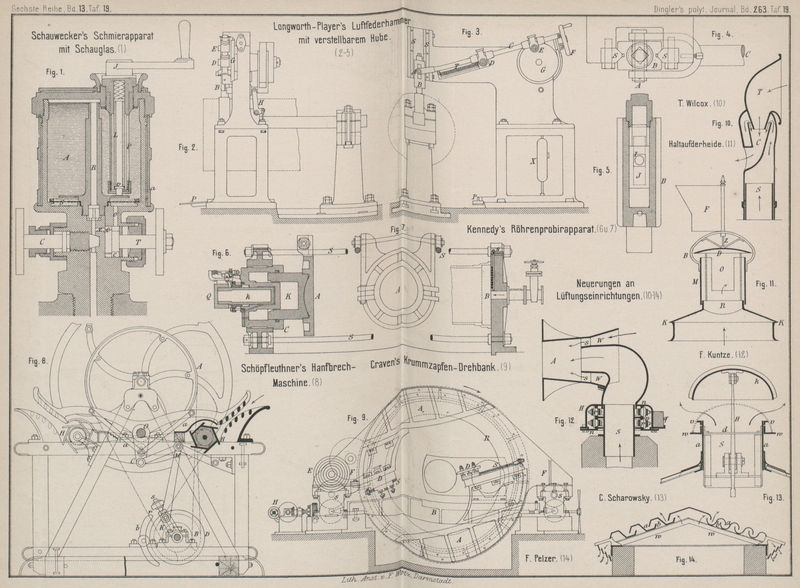| Titel: | Longworth's Luftfederhammer mit verstellbarem Hube. |
| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 318 |
| Download: | XML |
Longworth's Luftfederhammer mit verstellbarem
Hube.
Mit Abbildungen auf Tafel
19.
Longworth-Player's Luftfederhammer.
Einen zu den verschiedenartigsten Blecharbeiten
geeigneten Hammer, bei welchem der als Fallblock dienende Luftcylinder in einer
senkrechten Schlittenführung gleitet und an das eine Ende eines doppelarmigen Hebels
angeschlossen ist, an dessen anderem Ende der Zapfen einer umlaufenden Kurbelscheibe
angreift, bringen J. und W.
Player in Birmingham nach Longworth's Patent
(vgl. auch 1878 227 * 524) zur Ausführung. Der Drehpunkt
des Doppelhebels ist derart verstellbar, daſs bei
gleichbleibendem Kurbelhube der Hammerhub bezieh. die Schlagstärke in Folge der verschieden groſsen Hebelarmlängen veränderlich
wird, die untere Hubgrenze aber immer nahezu gleich bleibt. Dies ist nothwendig,
weil bei Blecharbeiten die Stärke der zu bearbeitenden Gegenstände sich nur wenig
ändert.
Hierzu wird, wie aus Fig. 3 Taf. 19 ersichtlich ist, der Drehzapfen D des Hammerhebels C auf demselben verschoben
und in einem Schlitze des Hammergestelles geführt, welcher etwa 15° gegen die Wagerechte geneigt ist.
Die Verstellung des Drehzapfens D wird mit Hilfe der
mit Handrad F versehenen Schraubenspindel T bewirkt. Der Hammerbär B
(vgl. Fig. 4
und 5) gleitet
zwischen zwei parallelen scharfkantigen Stahlschienen S, die besonders am Gestelle befestigt werden. Ein Riemen, auf loser und
fester Scheibe laufend, treibt die Kurbelscheibe G an.
Zur Vermeidung einer Lenkstange verschiebt sich das Lager des Kurbelzapfens E mit einer Hülse auf dem als cylindrische Stange
ausgebildeten Doppelhebel C, wie in gleicher Weise der
Drehzapfen D, so daſs der Gabelzapfen bei A am Hammerbär nur geringen Druck in der Hebelrichtung
auszuhaken hat. Der Hammerbär B ist ausgebohrt und
enthält nach Fig.
5 einen Kolben J mit einem durchgesteckten
viereckigen Gleitstücke I, durch welches der
Gabelzapfen reicht, die Bewegung von Kolben und Bär also nicht starr verbunden
erfolgt. Deshalb besitzt der Hammerbär lange Schlitze für das Gleitstück I. Die Räume über und unter dem Kolben J wirken als Luftbuffer und die Luft als ein treibendes
Zwischenmittel in den Todtpunktstellungen der Kurbel.
Die Aus- und Einrückung der Hammerbewegung wird durch einen Fuſstritt P, welcher durch eine mit Gewicht X belastete Stange auf einen den Riemenführer
bewegenden Winkelhebel H (vgl. Fig. 2) wirkt, vermittelt.
Das Gewicht X sucht den Hammer stets auszurücken. Den
verschiedenen Arbeitszwecken entsprechend erhält der Ambosuntersatz mannigfaltige
Ausführungen. So stellen die dem Engineering, 1886 Bd.
62 * S. 485 entnommenen Figuren 2 und 3 Taf. 19 einen
in zwei Lagern gehaltenen Querstab dar, welche Anordnung für Rohrarbeiten benöthigt
wird.
Tafeln