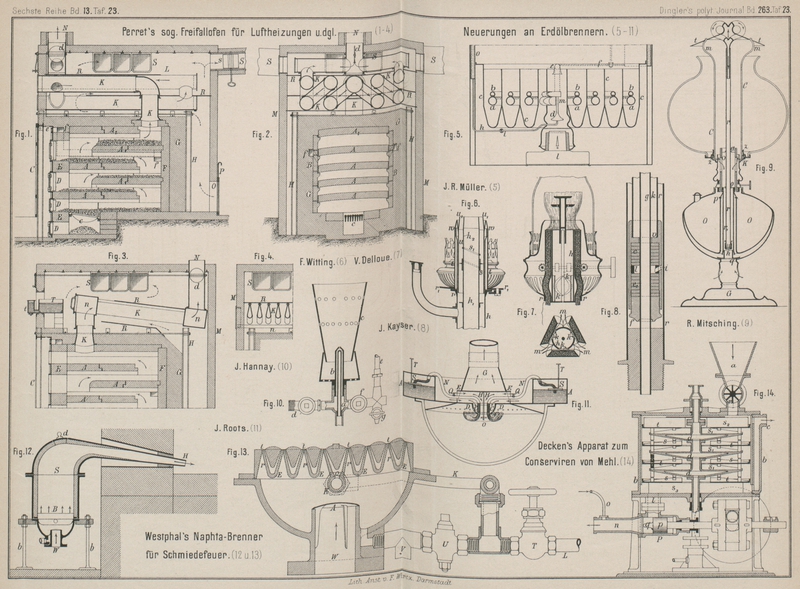| Titel: | Westphal's Naphta-Brenner für Schmiedefeuer; von A. G. Besson in St. Petersburg. |
| Autor: | A. G. Besson |
| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 373 |
| Download: | XML |
Westphal's Naphta-Brenner für Schmiedefeuer; von
A. G. Besson in St. Petersburg.
Mit Abbildungen auf Tafel
23.
Westphal's Naphta-Brenner für Schmiedefeuer.
Naphta und Naphtarückstände haben in neuerer Zeit eine weite Verbeitung als
Brennmaterial gefunden; man beginnt nun in Ruſsland, dieses flüssige Brennmaterial
auch für metallurgische Zwecke anzuwenden, und zeichnet sich unter den verschiedenen
hierzu angegebenen Apparaten besonders der in Fig. 13 Taf. 23
dargestellte Westphal'sche Naphtabrenner für
Schmiedefeuer aus.
Aus einem 1 bis 2m über dem Brenner befindlichen
Behälter gelangt die Naphta durch das Rohr L und das
Ventil T in die Rohrleitung K und durch kleine Oeffnungen o in die
ringförmigen, in einander liegenden Rinnen E, um aus
diesen durch die ebenfalls ringförmigen Spalten nach oben auszutreten. Hier wird die
Naphta durch den im Rohre W, dessen Mündung durch ein
Ventil A zu stellen ist, von einem Gebläse erzeugten
einströmenden Luftstrom, der sich in die zwischen den Spalten t liegenden Zwischenräume r vertheilt, getroffen und zerstäubt, so daſs sie beim Entzünden eine
ungemein kräftige Flamme bildet, welche durch den mit feuerfestem Material
gefütterten Schnabel S (vgl. Fig. 12) bei H in den Schmiedeherd eintritt.
Die Entzündung der Naphta oberhalb des Brenners B
erfolgt mittels einer Fackel durch eine mit Deckel d
verschlieſsbare Oeffnung in dem Schnabel S. Der mit der
Leitung L verbundene Hahn U dient zur Entleerung der Rohrleitung L von
Naphta durch den Stutzen V, wenn dies erforderlich
wird. Der ganze Apparat ruht, wie aus Fig. 12 ersichtlich, auf
4 Stützen b und ist überall leicht aufstellbar. Für
Reinigungszwecke kann der eigentliche Brenner B leicht
herausgenommen und nachgesehen werden; jedoch soll dies bei vorsichtigem Arbeiten
nur sehr selten nöthig sein.
Als Hauptvortheile dieses Brenners werden angeführt: die Erzielung einer sehr hohen
Temperatur und der Möglichkeit, dieselbe einzuhalten, reine Flamme ohne Ruſs und
ohne schädliche Gase, leichte Regulirung der Flammenstärke und reine und billige
Arbeitsweise.
Es werden bis jetzt 3 Gröſsen dieses Brenners gefertigt von 150, 200 und 250mm äuſserem Durchmesser. Der Preis eines 200mm-Brenners beträgt in Baku etwa 250 M., der
stündliche Naphtaverbrauch etwa 15k. Der
beschriebene Apparat hat in Baku und an der Wolga bereits groſse Verbreitung
gefunden und soll sich sehr vortheilhaft bewähren. (Vgl. Engler 1886 260 * 441.)
Tafeln