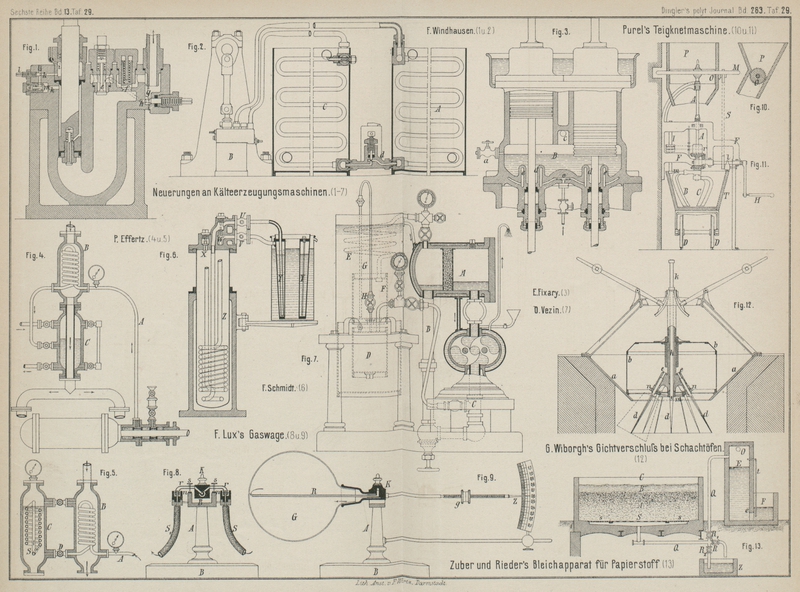| Titel: | Zuber-Rieder's Apparat zum Bleichen von Papierstoff. |
| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 485 |
| Download: | XML |
Zuber-Rieder's Apparat zum Bleichen von
Papierstoff.
Mit Abbildung auf Tafel
29.
Zuber-Rieder's Apparat zum Bleichen von Papierstoff.
Die bekannten französischen Papierfabrikanten Zuber, Rieder
und Comp. haben ein Verfahren und einen dazu bestimmten Apparat zum
Bleichen von Papierstoff (vgl. Französisches Patent Nr. 176771) angegeben, bei
welchem die Bleichflüssigkeit durch die in einem Kasten mit Siebboden befindliche
Stoffschicht durch Vermittelung einer unter derselben hergestellten Luftverdünnung von der äuſseren
Luft getrieben wird, wie dies bei der Reichling'schen
Bleichanlage (vgl. 1885 256 * 559) der Fall ist.
Bei dem neuen, in Fig. 13 Taf. 29
dargestellten Apparate zerlegt man nach der Papierzeitung, 1887 * S. 35 eine bestimmte Menge des zu bleichenden
Papierstoffes in zwei Theile, deren Mengenverhältniſs zu einander von der Art des
Papierstoffes abhängt. Der erste Theil wird in einem Holländer mit Wasser gemischt
und in den rechteckigen Kasten C abgelassen, welcher
mit einem Siebboden S und s versehen ist. Unter demselben wird die Luft abgesaugt, bis der
Papierstoff auf den gewünschten Grad entwässert ist. Nunmehr verdünnt man den
zweiten Theil des Papierstoffes mit Wasser und setzt diesem Theile die bleichende
Chlorverbindung zu, welche möglichst concentrirt sein muſs und deren Menge zum
Bleichen der ganzen Papierstoffmenge, also beider Theile genügen muſs, wobei ein
kleiner, durch die Erfahrung zu bestimmender Ueberschuſs an Chlor verbleiben soll.
Der so mit Bleichflüssigkeit versetzte zweite Theil des Papierstoffes wird nun über
den ersten, im Kasten C befindlichen gegossen, so daſs
sich über dem ersten Theile A eine flüssige Schicht B bildet. Unter dem Einflusse der Luftverdünnung unter
S wird die Bleichflüssigkeit durch den unteren
Theil gesaugt, wobei sie allmählich das in letzterem noch vorhandene Wasser
verdrängt. Man kann annehmen, daſs beide Theile A und
B vollkommen gleichmäſsig mit der gewünschten Menge
Bleichflüssigkeit getränkt sind, sobald der Papierstoffschicht B ihre Flüssigkeit völlig entzogen ist. Zum Schlusse
saugt man einen Sprühregen klaren Wassers durch die Masse, um alles Chlor
auszuwaschen. Beständiges und regelmäſsiges Saugen erzielt man mit Hilfe einer
Saugvorrichtung, die aus einer Kammer E gebildet wird,
in deren oberen Raum ein Rohr O einer Luftpumpe o. dgl.
mündet. Unter dem Einflüsse der durch die Luftpumpe bewirkten Luftverdünnung steigt
das Wasser des offenen Gefäſses F in der Kammer E, bis die Oberfläche des Wassers in F am unteren Rande der Scheidewand bei e steht. Bei etwaigem weiterem Saugen tritt die Luft
unter der Scheidewand e in den Raum E ein. Die Wassersäule in E zeigt daher den Grad der Luftverdünnung an und wird dieselbe auf einem
Standrohre t abgelesen. Das Rohr Q setzt die Kammer E in
Verbindung mit dem Kasten C und ist auſserdem bis in
das Gefäſs Z weitergeführt. Angenommen, die Hähne R1 und R2 seien offen und der
Hahn R geschlossen, so muſs das Wasser des Gefäſses Z so hoch in Q aufsteigen,
bis die Wassersäule in Q dem Unterschiede der
Wasserhöhen in den Gefäſsen E und F entspricht. Die durch den Siebboden von C abgesaugte Flüssigkeit wird dann fortwährend durch
den Hahn R2 in das
Gefäſs Z abflieſsen, ohne daſs der Grad der
Luftverdünnung irgendwie beeinfluſst wird. Um die Luftverdünnung möglichst
zweckentsprechend auf den Siebboden wirken zu lassen, theilt man denselben in
concentrische Theile von verschiedener Siebblechweite. In dem mittleren Theile S stehen die Löcher ungefähr 4mal so weit als in dem
äuſseren Theile s; auch reichen die Siebe nicht bis
ganz an den Rand des Bodens von C.
Ein geringer Ueberschuſs von Chlor wird, wie oben bemerkt, dem
zweiten Theile des Papierstoffes zugesetzt, damit in die untersten Schichten des zu
bleichenden Papierstoffes jedenfalls noch eine genügend concentrirte Lösung des
Bleichmittels dringe. Dieser Ueberschuſs ist jedoch nicht verloren, wenn man die
Flüssigkeit, welche durch den Siebboden abflieſst, vom Beginne der Bleichwirkung bis
zur Beendigung des Auswaschens sammelt. Diese schwachen Laugen können daher beim
nächsten Bleichen wieder verwendet werden. Die Menge der frischen Chlorlösung,
welche bei dem nächsten Bleichen gebraucht wird, vermindert sich dabei um den Gehalt
an Chlor, den die gesammelten schwachen Laugen enthalten.
Tafeln