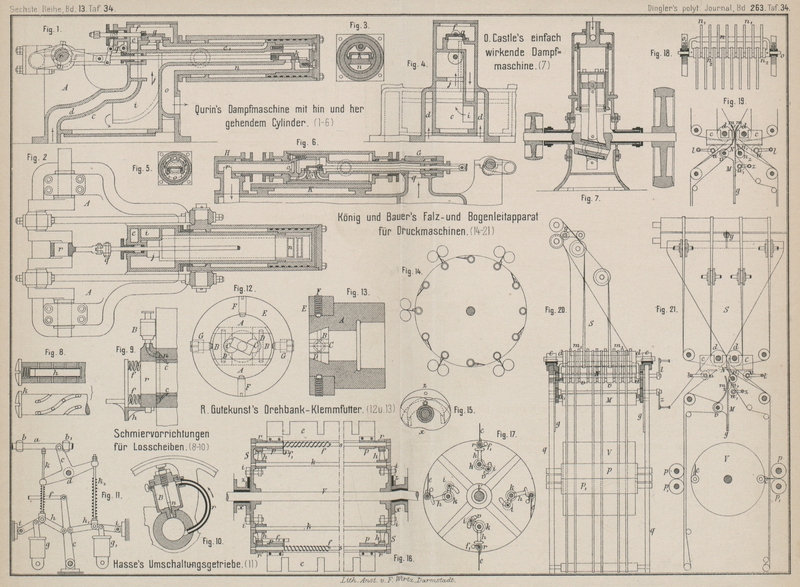| Titel: | Qurin's Dampfmaschine mit hin und her gehendem Cylinder. |
| Fundstelle: | Band 263, Jahrgang 1887, S. 555 |
| Download: | XML |
Qurin's Dampfmaschine mit hin und her gehendem
Cylinder.
Mit Abbildungen auf Tafel
34.
Qurin's Dampfmaschine mit hin und her gehendem
Cylinder.
Jene Anordnung der Dampfmaschine, wobei der Kolben feststeht und der Cylinder sich
hin und her bewegt (vgl. F. Voigt bezieh. Lappe 1882 243 * 269), hat
bis jetzt nur sehr vereinzelte Ausführungen gefunden, welche wohl schon wieder der
Vergessenheit anheim gefallen sind. Diese Erscheinung ist hinreichend in dem
Umstände begründet, daſs die fraglichen Dampfmaschinen, abgesehen etwa von der
Möglichkeit eines sehr gedrungenen Baues, den üblichen Kolbenmaschinen gegenüber
keinerlei Vorzüge besitzen, wohl aber sehr erhebliche grundsätzliche Nachtheile. Zu
diesen gehört in erster Linie die groſse Masse der hin und her gehenden Theile,
welche selbst bei möglichster Ausgleichung durch Gegengewichte am Schwungrade einer
raschen Bewegung sehr ungünstig ist, sowie die schwer zugängliche Lage der
Dampfvertheilungsorgane, wodurch die Beaufsichtigung und Regulirung der letzteren
sehr erschwert wird, abgesehen von mancherlei anderen weniger bedeutenden
Nachtheilen, wie vergröſserte Reibung, Schwierigkeit bezieh. Unmöglichkeit,
Präcisionssteuerungen zu verwenden u.s.w.
Von diesen grundsätzlichen Fehlern ist natürlich auch die neue Maschine von Ig. Qurin in Düsseldorf (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 36612
vom 17. Januar 1886) nicht frei, so sorgfältig dieselbe auch in Bezug auf mancherlei
Einzelheiten durchgearbeitet erscheint. Fig. 1 bis 4 Taf. 34 zeigen eine der
von Qurin getroffenen liegenden Anordnungen solcher
Dampfmaschinen. Mit dem Ständer A, in welchem die
dreifach gekröpfte Kurbelwelle gelagert ist, hängt die wagerechte Kolbenstange
zusammen, in deren Innerem sich die gesammten Dampfkanäle angeordnet finden. Die
Anordnung entspricht dabei insofern der Compoundmaschine, als das Ausschieben des Cylinders
durch die Expansion desselben Dampfes bewirkt wird, welcher vorher unter
Hochdruckspannung den Cylinder eingeschoben hat.
Der Ständer A ist hohl gegossen; der Kesseldampf tritt
zunächst in den Kanal d ein, welcher den inneren
Hohlraum c mantelartig von drei Seiten umgibt.In der Patentschrift ist dieser Raum c als
„Receiver“ bezeichnet; seine Thätigkeit deckt sich aber nicht mit
der des bei Compoundmaschinen mit rechtwinkelig stehenden Kurbeln
angewendeten Zwischenbehälters, sondern erscheint als ein einfacher
Wärmapparat für den abströmenden Hochdruckdampf. Aus dem Kanäle
d gelangt der Dampf durch den lothrecht
emporsteigenden Kanal e in den ersten Schieberkasten
f, aus welchem der Schieber g den Dampf während einer entsprechenden Zeit durch den Kanal e1 in den ringförmigen
Raum zwischen Kolbenstange und Cylinder einströmen läſst, so daſs der Dampf die
Verschiebung des Cylinders nach links bewirken kann. Der Cylinder selbst ist, wie
Fig. 1 und
2 deutlich
zeigen, durch eine Stopfbüchse an der Kolbenstange sowie durch den langen, an die
letztere angeschraubten Kolben in seiner eigenen Bohrung geführt. Bei der
Rückbewegung des Cylinders strömt der Dampf aus dem äuſseren ringförmigen Raume
unter der Höhlung des Schiebers durch den Kanal i in
den Raum c (Fig. 1 und 4), woselbst er sich durch
den Einfluſs des umgebenden Dampfmantels d wieder
erwärmt; damit dies möglichst vollkommen geschehe, ist der Kanal i bogenförmig bis in den hinteren (linken) Theil des
Behälters c geführt. Von hier aus geht der Dampf durch
die Oeffnung j und den centralen Kanal der Kolbenstange
nach dem innerhalb des Kolbens befindlichen Schieber k,
durch welchen der Dampf nunmehr in den Raum hinter dem Kolben gelangt und den
Cylinder ausschiebt. Beim Rückgange des letzteren endlich entweicht der Dampf,
nachdem er sich beträchtlich ausgedehnt hat, unter der Schieberhöhlung weg durch den
Kanal n und die Oeffnung o. Fig.
3 zeigt einen Querschnitt durch den Schieber k und die Kolbenstange, aus welchem sich die Anordnung der Kanäle deutlich
ersehen läſst. Der Querschnitt des Raumes hinter dem Kolben ist etwa dreimal so
groſs als der ringförmige Raum um die Kolbenstange.
Die Bewegung der Schieber erfolgt von der Wellenkröpfung r aus, indem
die hier angelenkte Excenterstange einestheils mit dem Schieber k im Inneren des Kolbens unmittelbar verbunden ist,
andererseits aber auch noch einen doppelarmigen Hebel q
in Bewegung setzt, an welchen die Stange des Schiebers g angeschlossen ist, welcher solchergestalt die erforderliche genau der
des Schiebers k entgegengesetzte Bewegung erhält. Der
Cylinder ist mit zwei Schildzapfen versehen, von welchen aus zwei Lenkstangen nach
den beiden Kröpfungen der Kurbelwelle gehen.
Wesentlich einfacher gestaltet sich natürlich die Maschine, wenn dieselbe nur einfach wirkend angeordnet wird. Es verschwindet
alsdann der erste Schieberkasten f und ebenso die
zusammengesetzte Hebelvorrichtung zur Bewegung des Schiebers g; weitere Vereinfachungen sind noch durch Anordnung der Kurbelwelle zur
Rechten des Cylinders möglich, indem dann die doppelte Kröpfung entbehrlich und ein
gewöhnliches Excenter zur Bewegung der Steuerung verwendbar wird.
Fig. 5 und
6
veranschaulichen eine Maschine, welche in gewöhnlicher Weise mit gleichem
Dampfdrucke auf beiden Seiten (also doppelt wirkend)
betrieben werden soll. Bei dieser ist die hohle Kolbenstange auch nach der anderen
Seite verlängert, so daſs man auf beiden Seiten gleiche Kolbenfläche erhält. Dabei
erfolgt der Zutritt des Dampfes in den Schieberkasten durch die rechtsseitige Stange
mittels der Oeffnung q, während der Austritt links
durch die Oeffnung r stattfindet. Aus Fig. 5, dem Querschnitte
durch die Mitte des Kolbens, und aus Fig. 6 ist deutlich
ersichtlich, wie der Austrittskanal o unter dem
Schieber sich seitlich in zwei Oeffnungen o1 fortsetzt, welche dann bei o2 (Fig. 6) in die linke
Kolbenstange münden. Der Kolben selbst besteht aus zwei mit je einer Kolbenstange
zusammengegossenen, durch Schrauben verbundenen Hälften, um so den Schieberspiegel
zugänglich zu machen. Bei G ist die Kolbenstange am
Gestelle befestigt, bei H aber wird sie nur durch eine
Stopfbüchse umschlossen, so daſs der Ausdehnung derselben in der Wärme kein
Hinderniſs entgegensteht. Bemerkenswerth ist noch die Unterstützung des Cylinders
durch eine über seine ganze Länge gehende Gleitbahn K,
wodurch jedenfalls eine bedeutende Schonung der Stopfbüchsen eintritt. Die Anordnung
der Kurbeln und der Steuerung unterscheidet sich, abgesehen davon, daſs nur ein Schieber zu bewegen ist, nicht wesentlich von jener
in Fig. 1 und
2.
Tafeln