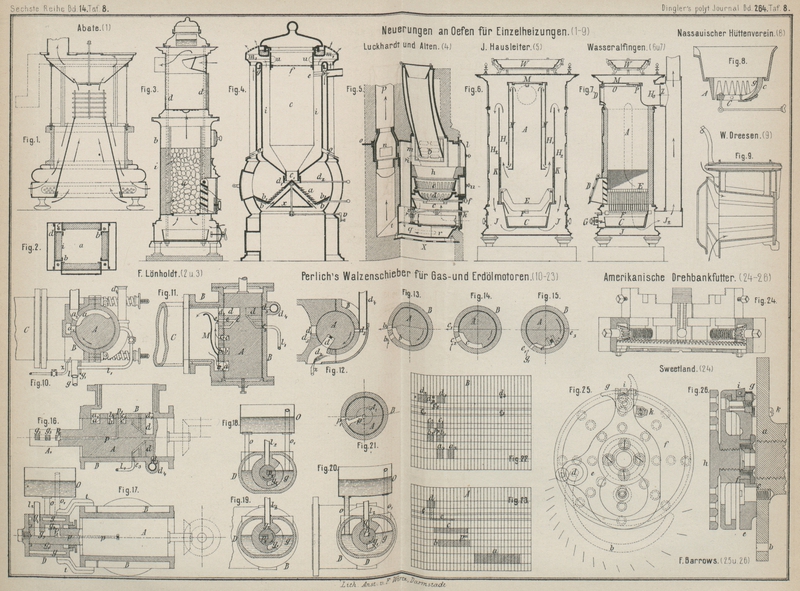| Titel: | Ueber Neuerungen im Heizungswesen. |
| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 111 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen im Heizungswesen.
(Patentklasse 36. Fortsetzung des Berichtes Bd.
260 S. 545 und Bd. 261 S. 245.)
Mit Abbildungen auf Tafel
8.
Ueber Neuerungen im Heizungswesen.
I) Einzelheizungen.
Um bei Kaminen durch Absperrung des Rauchabzuges eine
längere Wärmeabgabe der glühenden Kohlen nach Aufhören des Feuers sowie ein
Warmhalten des Feuerraumes zu erzielen, will Emil
Benver in Berlin (* D. R. P. Nr. 35634 vom 20. Oktober 1885) den Planrost unabhängig vom Aschenkasten, der mit
Schiebedeckel versehen ist, anordnen und nach Aufhören des Feuers durch Herausziehen
des Planrostes die glühenden Kohlen in den Aschenkasten fallen lassen, in welchem
sie noch einige Zeit Wärme abgeben; hierbei wird der Aschenkasten geschlossen und
die noch sich entwickelnden Gase werden durch ein enges, regelbares Rohr aus
demselben nach dem Schornstein geleitet.
Der Kachelofen der Firma J. und
H. Ehrlich in Wien ist nach dem
Metallarbeiter, 1886 * S. 215 zerlegbar und enthält einen cylindrischen, mit Füllschacht versehenen
Feuerraum, der zunächst von einem Blechmantel und dann von dem Kachelmantel umgeben
ist; zwischen den beiden letzteren wird die Zimmerluft oder von auſsen zugeführte
Frischluft durchgeleitet.
Alois Steinhauser in München (* D. R. P. Nr. 36271 vom
26. Juni 1885) empfiehlt zur vollkommenen Verbrennung die Kohlen von unten in die Feuerung einzuführen (vgl. Melville 1885 256 * 262. Holdinghausen 1886 261 * 72)
und die Verbrennungsluft von oben zuzuleiten. Hierzu
ist in der Mitte des Ofens ein cylindrischer Schacht angebracht, welcher oben in den
Feuerraum mündet und mit seitlicher Kohlenzuführung versehen ist. Das Brennmaterial
fällt auf einen Teller, welcher in dem Schachte durch Hebel von auſsen aufwärts
bewegt werden kann, so daſs er den Feuerraum unten abschlieſst. Soll frisches
Brennmaterial eingebracht werden, so hält man die im Feuerraume brennenden Kohlen
durch eine eingesteckte Gabel zurück, bewegt den Teller abwärts und beschickt mit
Kohlen, welche dann bei der Aufwärtsbewegung des Tellers unter die glühende Schicht
rücken. Die Einführung der zur Verbrennung nöthigen Luft geschieht durch ein Rohr,
welches dicht über den Kohlen einmündet.
Einen eisernen Schürofen mit sichtbarem Feuer hat den in
England und Frankreich gebräuchlichen Formen entsprechend Abate in London construirt. Als Brennmaterial soll nach dem Engineer, 1886 Bd. 62 * S. 463 Anthracit oder Pechkohle
verwendet werden, welche in einem Rostkorbe verbrennt
(vgl. Fig. 1
Taf. 8). Der obere Theil des Ofenmantels wird durch Glasscheiben gebildet, welche
geöffnet werden können, um die strahlende Wärme des Feuers besonders auszunutzen.
Der Weg der Verbrennungsluft und der Feuergase ist durch Pfeile angegeben. Die in
den Sockel seitlich eintretende Luft kann durch Oeffnen der Glasthüren auch zur
Erwärmung des Zimmers benutzt werden. Die Glasscheiben werden allerdings keine
groſse Dauerhaftigkeit besitzen und die untere Hälfte des Ofens erscheint für die
Heizung ziemlich nutzlos.
Um zu gewissen Zeiten ein langsames Fortbrennen, z.B.
bei Nacht, zu erzielen, will Canis nach dem Génie
civil, 1886 Bd. 9 * S. 297 die Richtung des Feuerzuges in folgender Weise
ändern: Der Ofen enthält einen cylindrischen Feuerraum, in welchen die Kohlen von
oben eingeworfen werden, dessen Boden durch einen Planrost gebildet wird und dessen.
Wandung bis zu etwa halber Höhe mit Löchern versehen ist. Der unter dem
Feuercylinder befindliche Aschenraum ist durch eine lothrechte Wand getheilt und in
der vorderen Hälfte ein ausziehbarer Aschenkasten angeordnet; von der hinteren führt
ein Rohrstutzen nach dem Rauchrohre, in welches ein zweiter Stutzen mündet, der vom
oberen Theile des Feuercylinders abgeht und eine Drosselklappe enthält. Die cylindrische Wandung des
Aschenraumes setzt sich nach oben fort und umgibt als Mantel den Feuercylinder, ist
durch einen Deckel geschlossen und gegenüber den Löchern des Feuerraumes mit zwei
Schiebethüren versehen. Für starkes Feuer wird die Drosselklappe im oberen
Rauchabzuge und die Aschenthür geöffnet; sollen die Kohlen nur langsam brennen, so
werden die Schiebethüren mehr oder weniger geöffnet und Drosselklappe wie Aschenthür
geschlossen. Hierdurch tritt Luft durch die Löcher über die Kohlen, welche dabei
nach abwärts brennen, indem die Rauchgase nun durch den unteren Stutzen
abziehen.
Aehnlich ist der für Kokesfeuerung eingerichtete Ofen von J.
A. Viville in Paris (* D. R. P. Nr. 36637 vom 29. December 1885). Das
Brennmaterial wird in einen stehenden Cylinder eingebracht und liegt auf zwei mit
ihren Stäben einander rechtwinkelig überdeckenden Rosten, von denen der obere
wagerecht drehbar ist, um die Kokesschicht zu lockern. Der Feuercylinder ist
seitlich mit Löchern versehen, durch welche die Feuergase in den Raum zwischen dem
Cylinder und einem Mantel treten, an den das Rauchrohr sich anschlieſst. Der als
abnehmbare Haube gestaltete Deckel des Feuercylinders greift in ein mit Wasser
gefülltes, zwischen Mantel und Cylinder angebrachtes ringförmiges Gefäſs, um einen
Wasserverschluſs gegen das Austreten von Gasen zu erhalten. Die rasche Entleerung
des Ofens nach dem Aschenkasten wird durch Herausziehen beider Roste bewirkt.
Münter in Herford (* D. R. P. Nr. 34556 vom 12. August
1885, Zusatz zu Nr. 27481) will bei seinem Füllofen,
welcher in einfachster Weise aus zwei auf
gemeinschaftlichem Feuerkasten neben einander stehenden
Säulen besteht, von denen die eine als Füllschacht, die andere als
Heizkörper dient, die Regelung der Wärmeabgabe durch Verstellung eines Schiebers
bewirken, der das Einfallen der Kohlen in den Feuerraum mehr oder weniger hemmt.
Franz Lönholdt in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 34896
vom 15. September 1885) hat an Füllöfen Steuerungen angegeben, welche bezwecken,
daſs der Ofen vollkommen zusammengebaut versendet
werden kann, so daſs sein Aufstellen und Ingangsetzen ohne Weiteres erfolgen kann.
Hierzu sind, wie Fig. 2 und 3 Taf. 8 zeigen,
winkelförmige Rippen b in der Innenwand des Feuerraumes
a so angegossen, daſs Kanäle c gebildet werden, durch welche Eisenstangen d gezogen sind, die den ganzen Ofen zusammen halten.
Zwischen den Rippen b werden Ausfütterungssteine i gesetzt und von ersteren gehalten. In den Kanälen c kann Luft hochströmen, sich erwärmen und durch
schlitzförmige Oeffnungen zur Feuerung gelangen.
Beim Kachel-Füllofen von Alb.
Conrad in Straſsburg i. E. (* D. R. P. Nr. 37449 vom 6. December 1885) soll
in den aus Kacheln aufgebauten Ofen ein eiserner Füllcylinder eingehängt werden.
Zugleich soll der Ofen jedoch auch ohne Füllfeuerung benutzt werden können, wozu
jedoch den Feuergasen
ein anderer Weg durch die Züge mittels Schiebereinstellung angewiesen wird.
Um für Füllöfen Grude zur Feuerung verwenden zu können,
haben Luckhardt und Alten in Kassel (* D. R. P. Nr.
37545 vom 19. März 1886) folgende Neuerungen angegeben: Der Rost hat nach Fig. 4 Taf. 8 Kegelform und ist mit wagerechten Löchern a zur Luftzuführung versehen; kleine Rippen über den
Löchern sollen verhindern, daſs sich diese zusetzen. Für groſse Feuerungen wird
statt dieses gelochten Kegels ein aus einzelnen, in kleinen Abständen über einander
liegenden Ringen bestehender Kegel empfohlen. Unter dem Rost ist ein zweiter Kegel
x angebracht, der durch einen von Hand zu
bewegenden Kurbelmechanismus v höher gestellt werden
kann, wodurch die freie Rostfläche vermindert werden soll, was jedoch aus der
Anordnung der Fig.
4 nicht ersichtlich ist. Zur Beseitigung der Asche dienen die Ringe b, b1, die mit gleich
groſsen Oeffnungen versehen sind und von welchen b
durch einen Handgriff drehbar gemacht ist. Wird nun der Ring b so gedreht, daſs die Oeffnungen in b und
b1 sich decken, so
fällt die auf b1
angesammelte Asche hindurch. Der Füllschacht c ist zu
einem Halse c1
zusammengezogen und eine Regelung der Brennstoffzuführung erfolgt durch Drehen des
Ringes d1 mittels
Handgriff d2
, wodurch der an c1 in schraubenförmiger Nuth bewegliche Ring d1 sich auf oder nieder
schiebt. Das Rohr e leitet etwa sich im Füllschachte
c entwickelnde Gase nach den Feuerzügen. Durch ein
Sieb f, welches mittels Handhaben u wagerecht gerüttelt und auch herausgenommen werden
kann, werden gröſsere Kohlenstücke zurückgehalten. Zur Reinigung der Feuerzüge ist
ein schwerer Ring g angebracht, welcher an Ketten
herabgelassen werden kann. Zwischen dem Füllschachte c
und dem Feuerzuge ist ein Raum i angeordnet, durch
welchen Zimmerluft streichen kann, indem sie bei o ein-
und bei m1
austritt.
Nach einer Mittheilung im Bayerischen Industrie- und
Gewerbeblatt, 1886 * S. 267 fertigt J. F.
Hausleiter in München Füllöfen, welche aus
einem eisernen Einsatz, welcher die Feuerstätte und die
Feuerzüge enthält, und einem Kachelmantel bestehen. Der
eiserne Füllschacht b ist, wie aus Fig. 5 Taf. 8 ersichtlich,
in den Hals des Einsatzes eingehängt und mit einem Fülltrichter versehen. Die
Rostanordnung besteht aus einem Planroste c, der durch
den Handgriff f herausgezogen werden kann, ferner aus
den Theilen d und e, von
welchen d von auſsen in schüttelnde Bewegung versetzt
werden kann. Ueber den Rosten ist ein Chamottering h
angebracht. Beim Anfeuern (durch die Thür l) wird
einunmittelbarer Zug der Feuergase von m nach n bezieh. nach dem Kamine p durch Verstellen des Schiebers n mittels
des Handgriffes o eingeleitet. Ist der Brand lebhaft
genug, so wird n geschlossen, so daſs nun die Feuergase
den längeren Weg durch die Züge i, q, r, t, n, p nehmen
müssen. Zur Erzielung eines langsamen Abbrennens wird der Schieber v
geöffnet. Die Zuführung
der Verbrennungsluft geschieht nur durch die Aschenthür k, die Reinigung der Roste durch die Thür u.
Durch seitlich an dem Einsatze vorbei führende Kanäle im Kachelmantel kann die durch
die Lochplatte X eintretende Zimmerluft behufs
schnellerer Erwärmung geleitet werden; auch ist eine Absaugung verdorbener Luft nach
dem Rauchrohre vorgesehen.
(Schluſs folgt.)
Tafeln