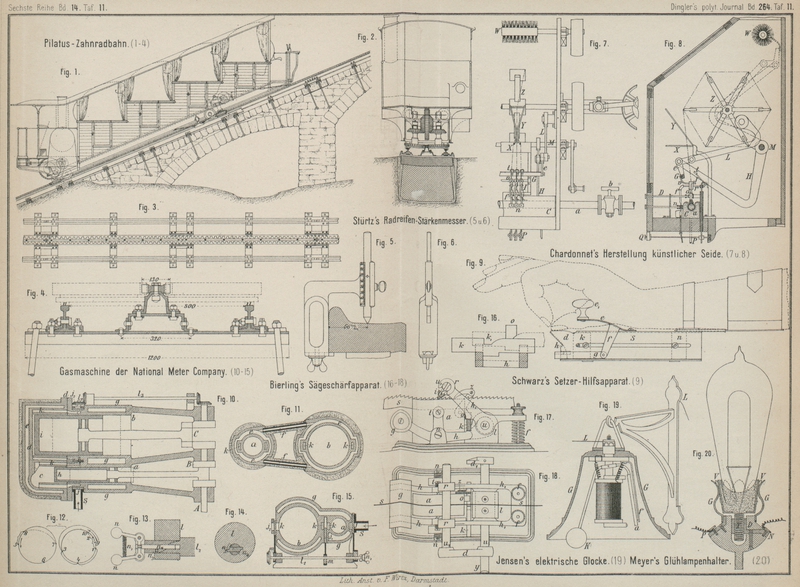| Titel: | C. A. Bierling's Sägeschärfapparat. |
| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 166 |
| Download: | XML |
C. A. Bierling's Sägeschärfapparat.
Mit Abbildungen auf Tafel
11.
Bierling's Sägeschärfapparat.
Der von C. A. Bierling in Dresden (* D. R. P. Kl. 38 Nr.
37414 vom 4. März 1886) angegebene Sägeschärfapparat arbeitet mit einer Feile (vgl. 1885 256 * 488),
welche in einem Gleitrahmen eingesetzt ist und mit einem Griffe an demselben über
das in einem Schraubstock o. dgl. eingespannte Sägeblatt hin und her gezogen werden
kann. Dabei wird die Feile selbstthätig auf den zu schärfenden Zahn niedergedrückt,
beim Rückgange aber abgehoben, damit die Verschiebung des Sägeblattes um eine
Theilung erfolgen kann, wobei die Klemmung des Blattes vorübergehend aufgehoben
wird.
Der Apparat ist in Fig. 17 und 18 Taf. 16 im
Längsschnitt und Grundriſs gezeichnet. Die Feile i ist
zwischen den Augen c des Rahmens oder der Gabel u1
duy eingespannt; diese Gabel ist im festen Lager l und links oben in den zwei Augen r eines Doppelhebels h1 geführt (welch letzterer durch Wirkung der Federn
f die Feile in die Zanhnlücke niederdrückt) und
erhält von Hand am Griffe y die Arbeitsbewegung quer
über das Sägeblatt s. Die Einspannung des Sägeblattes
erfolgt zwischen den zwei Backen a in der Art, daſs
letztere beim Eintreten der Schaltbewegung das Blatt nicht klemmen.
Wenn nun die Gabel uu1
mit Hilfe des Griffes y in hin und her gehende Bewegung
versetzt wird, so erfolgt beim Hingange die Schärfung eines Zahnes. Gegen Ende
dieses Ausschubes stöſst der Querarm d gegen einen Keil
k, welcher mit einem in Fig. 16 näher
ersichtlichen Einschnitt k1 versehen ist. Durch die Verschiebung des Keiles kommt dieser
Keilausschnitt k1 unter
eine am Spannbacken a angegossene Nase o zu liegen, in Folge dessen der Keil k vermöge des Gewichtshebels hg hochgeht und durch seinen Anschlag an den Hebel h1 die Feile i aus dem Sägeblatte aushebt. Gleichzeitig werden durch die Drehung des in
Schraubenspitzen n schwingenden Hebels hg die nach der Sägeblattstärke einstellbaren Schrauben
t von den schiefen Flächen der Einspannbacken a zurückgezogen, letztere dadurch von selbst geöffnet
und das Sägeblatt durch eine Klinke z nach links
verschoben. Beim Rückgange der Gabel uu1 führt nun der Daumen d1 den Keil k
mit den übrigen Theilen wieder in die frühere Lage zurück und die Klinke z fällt in die nächste Zahnlücke. Durch das Sinken des
Hebels h schlieſsen die Schrauben t die Backen a und unter
dem Einflüsse der Feder f senkt sich der Hebel h1 mit der Feile i auf den nächsten zu schärfenden Zahn.
In einer zweiten Anordnung ruht die Stange u1 nicht in einem festen Lager l, sondern in einem Auge des Hebels h, wie in Fig. 17 gestrichelt
eingezeichnet ist, wodurch ein höheres Abheben der Feile vom Sägeblatte s erzielt wird.
Tafeln