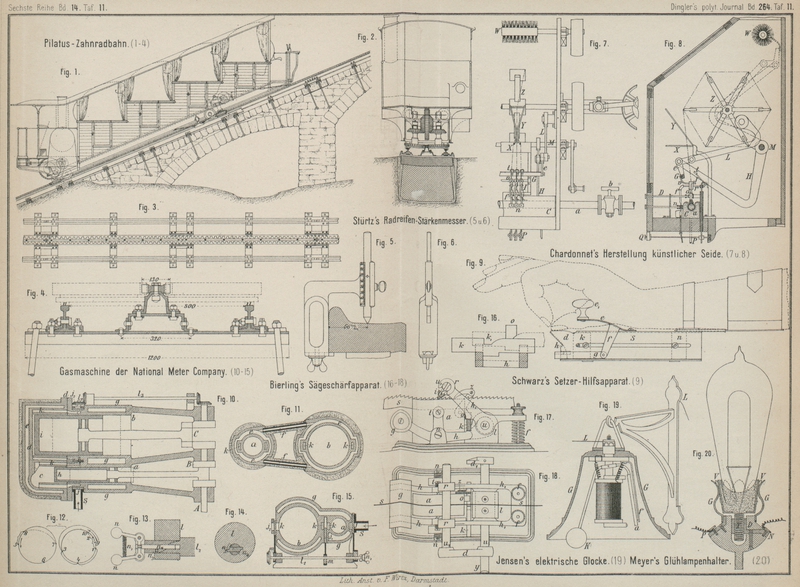| Titel: | H. de Chardonnet's Verfahren zur Herstellung künstlicher Seide. |
| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 172 |
| Download: | XML |
H.
de Chardonnet's Verfahren zur Herstellung
künstlicher Seide.
Mit Abbildungen auf Tafel
11.
Chardonnet's Verfahren zur Herstellung künstlicher
Seide.
Den natürlichen Vorgang bei der Erzeugung der Seide sucht H.
de Chardonnet in Besançon, Frankreich (vgl. D. R. P. Kl. 29 Nr. 38368 vom
20. December 1885) künstlich nachzuahmen, indem er aus besonders zusammengesetzten
Flüssigkeiten zähe, biegsame und glänzende Fäden ziehen will. Die benutzte
Flüssigkeit ist eine Art Collodium, welches durch Auflösen von Pyroxylin, eines
reducirenden Metallchlorüres und einer kleinen Menge einer oxydirbaren organischen
Base in einer Mischung von Aether und Alkohol erhalten wird; das Pyroxylin ist dabei
auf bekannte Weise durch Nitrirung gereinigter Cellulose von Holz, Stroh, Baumwolle
u.s.w. gewonnen worden. Eine Lösung, welcher man noch je nach der gewünschten
Färbung der daraus hergestellten Seide einen Farbstoff zusetzt, erhält man, wenn in
dem gröſseren Theile eines Gemisches von 2 bis 5l
aus 40 procentigem Aether mit 60 procentigem Alkohol in der Wärme etwa 100g Pyroxylin, in dem kleineren Theile der Mischung
10 bis 20g Eisen-, Chrom-, Mangan- oder
Zinnchlorür mit 0g,2 Chinin, Anilin, Rosanilin o.
dgl. und dem Farbstoffe gelöst und beide Mischungen dann vereinigt werden.
Wenn man eine solche heiſse Flüssigkeit durch ein enges Mundstück austreten läſst und
den austretenden Strahl durch Wasser o. dgl. sofort kühlt, so erstarrt der Strahl
und bildet einen Faden.
Der zur Ausführung dieses Verfahrens dienende Apparat ist in Fig. 7 und 8 Taf. 11 nach
der englischen Patentschrift 1886 Nr. 2211 veranschaulicht. Die auf die angegebene
Weise zubereitete heiſse Flüssigkeit wird von einem geschlossenen Behälter
aufgenommen, in welchem dann durch Preſsluft o. dgl. ein Druck von 2 bis 3at erzeugt wird. Dieser Druck preſst die
Flüssigkeit durch den Hahn b (Fig. 7) in das Rohr a; dasselbe besitzt auf der oberen Seite eine Reihe
Rohransätze eingeschraubt, auf welcher mit dünner Gummipackung kurze Rohrstücke d befestigt werden. Letztere stehen durch kurze
Gummischläuche mit kurzen Glasröhrchen I in Verbindung,
welche oben zu feinen Mundstücken von etwa 0mm,1
lichter Weite ausgezogen sind. Durch stärkeres oder geringeres Klemmen der
Gummischläuche mittels der Schrauben D kann der
Ausfluſs jedes einzelnen Glasröhrchens I geregelt
werden. Das Mundstück dieser Röhrchen I wird von
arideren Glasröhrchen J umschlossen, in welche aus dem
das Rohr a umschlieſsenden Behälter C kaltes Wasser durch die biegsamen Röhrchen f geleitet wird; der Wasserzufluſs wird dabei durch die
Schlauchklemmen bei n geregelt. Die Röhrchen J können ganz genau eingestellt, also gehoben und
gesenkt werden, indem dieselben an den Stiften r an
senkrechten Spindeln hängen, welche von den Köpfen Q
aus mittels Zahnstangentriebes bei P leicht und schnell
bewegt werden.
Zu Beginn des Arbeitens mit diesem Apparate werden die
Glasröhrchen J ganz tief gestellt, so daſs die
Mundstücke der Röhrchen I gleichzeitig durch Plättchen
J, welche an leicht beweglichen Armen (vgl. Fig. 8) sitzen,
geschlossen gehalten werden. Bewegt man die Spindeln P
etwas aufwärts, so werden die Mündungen durch Abheben der Plättchen J, indem die Spindelenden unter t fassen (vgl. punktirt in Fig. 8), frei gemacht und
tritt die Flüssigkeit in feinem Strahle aus, welcher in Folge des nach J geleiteten Wassers erstarrt. Vorher wurde auch die an
dem Winkelhebel e befestigte Schiene G niedergedrückt, so daſs die Nadeln v derselben in die Nähe der Mundstücke l zu stehen kommen. An diesen Nadeln haftet der
ausgetretene Strahl, worauf die Schiene G durch
Bewegung des um die Achse M drehbaren Hebels H nach aufwärts geführt wird, so daſs der sich bildende
Faden dieser Bewegung folgen kann. Die richtige Bewegung von G vermittelt der Gegenlenker L und gelangt
schlieſslich die Schiene G in die Nähe der umlaufenden
Walzenbürste W. Der aufgezogene, in den Führer Y eingelegte Faden wird an dem Haspel Z befestigt, welcher denselben nun aufwindet, während
gleichzeitig die Nadeln r der Schiene G von der Bürste W
gereinigt werden. Sind mehrere Faden gleich zusammen zu winden, so werden dieselben
über Leitdrähte X von dem Führer Y zusammengenommen. Der Haspel Z macht behufs gleichmäſsiger Aufwindung eine hin- und hergehende
Bewegung, welche auf die aus Fig. 7 ersichtliche Weise
von einer Kurbelscheibe aus abgeleitet wird.
Das Ganze ist in einem Kasten untergebracht, in welchem eine
Temperatur von etwa 30° erhalten wird. Das Trocknen der Fäden kann auch durch eine
Luftverdünnung in dem Kasten beschleunigt werden.
Tafeln