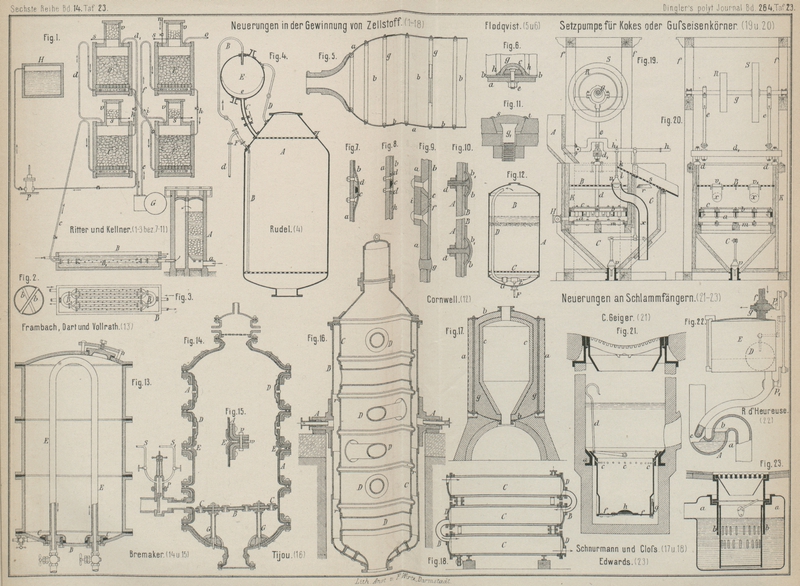| Titel: | Neuerungen an Schlammfängern für Strassenausgüsse. |
| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 380 |
| Download: | XML |
Neuerungen an Schlammfängern für
Straſsenausgüsse.
Patentklasse 85. Mit Abbildungen auf Tafel 23.
Neuerungen an Schlammfängern für Straſsenausgüsse.
Die bei den üblichen Schlammfängern vorhandenen Miſsstände: Schlammablagerung
auſserhalb der Schlammkästen und dadurch hervorgerufene schwierige Reinigung und
Handhabung, sucht Carl Geiger in Karlsruhe (* D. R. P.
Nr. 38210 vom 10. Juli 1886) durch die in Fig. 21 Taf. 23
wiedergegebene Einrichtung zu vermeiden, durch welche der sogen. schädliche Raum auſserhalb des Eimers abgeschlossen
wird.
Der Schlammfänger hat einen runden, sich unterhalb der
Ausfluſsöffnung verengenden Querschnitt, dessen Uebergang durch den abgedrehten und
in die Schlammfangwandungen eingelassenen Guſseisenkranz a gebildet wird; auf diesem sitzt der gleichfalls kegelförmig abgedrehte
guſseiserne Eimerkranz b dicht so auf, daſs der Eimer
nicht auf dem Boden des Schlammfängers aufsteht, sondern frei in demselben hängt. In
Folge dessen muſs sich aller Schlamm in dem Schlammkasten ablagern und es kann wegen
des dichten Aufsitzens des Eimerrandes niemals Schlamm in den sogen. schädlichen
Raum gelangen. Auſserdem sind rings in den Eimerkranz die von innen nach auſsen
aufsteigenden Löcher c gebohrt, wodurch der schädliche
Raum mit dem übrigen Schlammfängerraume in Verbindung steht, so daſs unter dem Eimer
der gleiche Druck herrschen muſs wie über demselben. Die Richtung der Löcher ist mit
Rücksicht darauf, daſs die sich ablagernden Schlammtheilchen einen nach abwärts
gerichteten Weg beschreiben, eine ansteigende und soll dadurch ein Verstopfen
derselben durch Schlamm bezieh. das Austreten desselben in den schädlichen Raum
verhindert werden. Ist nun der Eimer mit Schlamm gefüllt, so ist beim Herausziehen
nur das Heben des Schlamm- und Eimergewichtes als Arbeit zu leisten, wobei durch das
Heben des Eimers sämmtlicher Schlamm aus dem Schlammfänger entfernt wird. Um diese
Arbeit zu erleichtern, ist der Eimer mit dem Haken d
versehen, welcher stets über den Wasserspiegel hervorragt und in Folge dessen leicht
zu fassen ist.
Der Eimer besitzt einen Klappboden f,
welcher durch einen kleinen, mit einem Schlüsselkopfe versehenen Reiber g geschlossen ist. Wird nun der Boden mittels eines
Schlüssels geöffnet, so fällt die Schlammasse durch das eigene Gewicht und die
Erweiterung des Eimers leicht heraus und das über dem Schlamme stehende Wasser spült
den Eimer gleichzeitig noch aus. Wird darauf der Klappboden wieder geschlossen und
der Eimer in den Schlammfänger hinabgelassen, so öffnet sich das im Eimerboden
befindliche Klappventil h und das im Schlammfänger
zurückgebliebene Wasser kann in den Eimer einströmen. Durch die Einströmungsbewegung
des Wassers werden die etwa auf dem Boden sitzenden feinen Schlammtheilchen
aufgewirbelt und mit in den Eimer hineingerissen. Hat sich derselbe dann wieder so
weit gesenkt, daſs der Rand b auf dem
Schlammfängerkranz a aufsitzt, so schlieſst sich in
Folge des gleichmäſsigen Druckes das Ventil von selbst und die Schlammansammlung
kann von Neuem beginnen.
Fig. 23 Taf.
23 stellt einen von Edwin Edwards in München (* D. R.
P. Nr. 34824 vom 26. August 1885) vorgeschlagenen Schlammfänger dar, dessen Neuerung
sich auf den Geruchsverschluſs bezieht.
Der Wasserspiegel hat im Kasten a
gegen den Wasserspiegel im Geruchsverschlüsse b eine
mehr als doppelte Oberfläche. Hiermit wird zweifaches erreicht: Einmal streicht die
warme Kanalluft über die groſse Wasserfläche a hin,
dieselbe erwärmend, wodurch eine stete Erneuerung des Wasserspiegels in b veranlaſst ist; es wird also ein Einfrieren der
Wasserfläche in b vermieden; ferner ist, wenn aus
irgend einem Grunde im Kanäle ein stärkerer Luftdruck entsteht, welcher auf den
Wasserspiegel a wirkt, nicht zu fürchten, daſs der
Geruchsverschluſs gebrochen würde; derselbe wird vielmehr erhöht, da dann das Wasser
im Geruchsverschlüsse b steigt. Umgekehrt ist ein
Absaugen des Verschluſswassers durch eine Abnahme des Luftdruckes im Kanäle nicht gut denkbar;
sollte aber dieser Fall eintreten, so ist genügend Schutz durch den 100mm hohen Wasserverschluſs gegeben. Bei
Verstopfungen in den Abfluſsröhren ist durch Herausnehmen des Schlammeimers und
Abheben des Geruchsverschlusses der Zugang zu den Abfluſsröhren frei und somit eine
Lösung der Röhrenverbindung nicht nöthig.
Um bei Schlammfängern, Geruchsverschlüssen u. dgl. das Austreten von Kanalgasen zu verhindern, verwendet R. Th. d'Heureuse in New-York (* D. R. P. Nr. 31696 vom 20. August 1884)
ein luftdicht geschlossenes, Desinfectionsflüssigkeit enthaltendes Gefäſs in
folgender Weise.
In dem Geruchsverschlüsse A (Fig. 22 Taf.
23) ist nahe unter dem höchsten möglichen Wasserstande b, während o den niedrigsten bezeichnet, eine
kleine Oeffnung c angebracht, von welcher ein Rohr zu
dem höher gelegenen geschlossenen Behälter E führt;
letzterer nimmt die Desinfectionsflüssigkeit mittels des Rohres f auf. Dabei wird der Hahn p geöffnet, dagegen der das Behälterinnere mit dem Wasserverschlusse
verbindende Hahn p1
geschlossen. Auſserdem muſs im Hahne p noch eine ins
Freie führende Oeffnung g vorhanden sein, zum Ableiten
der Luft aus dem Behälter E, wenn derselbe gefüllt
wird. Die Hähne p und p1 sind mittels einer Zugstange mit einander verbunden, um die Stellungen
derselben gegenseitig abhängig zu machen. Die Zugstange kann man mit einem im
Behälterinneren befindlichen Schwimmer D verbinden, um
die Füllung des Behälters selbstthätig aus einem gröſseren Vorrathsbehälter zu
bewerkstelligen. Nach stattgefundener Füllung dreht man die Hähne p und p1 so, daſs p
geschlossen, p1 aber
geöffnet ist. Es flieſst dann aus dem Behälter E so
viel Flüssigkeit in den Wasserverschluſs A, bis die
Oeffnung c überdeckt ist. Luft und Flüssigkeit gehen in
dem Rohre an einander vorbei. Verdunstet im Wasserverschlusse die Flüssigkeit so
weit, daſs die Oeffnung c wieder freigelegt wird, so
flieſst neuerdings etwas Desinfectionsflüssigkeit nach, bis c wieder überdeckt ist. Ein vollständiges Austrocknen von A kann also nie stattfinden.
Tafeln