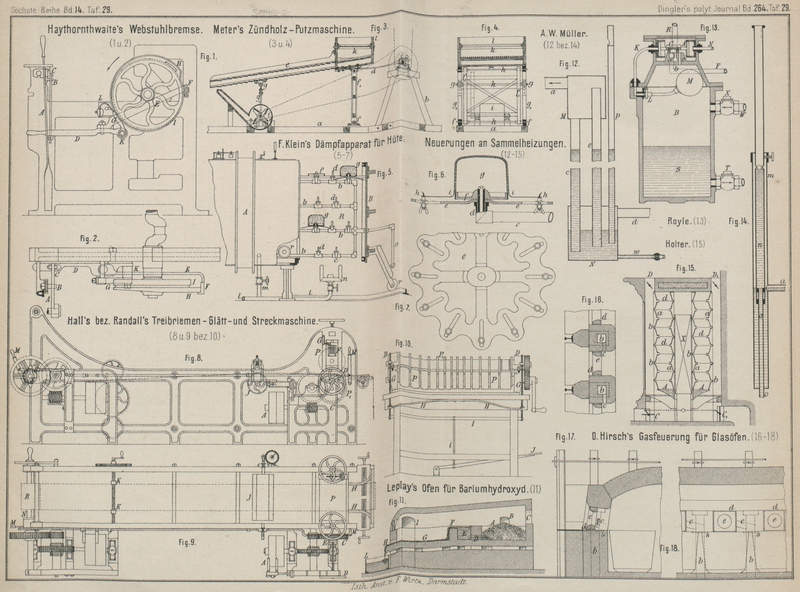| Titel: | F. Klein's Apparat zum Dämpfen von Hüten. |
| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 490 |
| Download: | XML |
F. Klein's Apparat zum Dämpfen von
Hüten.
Mit Abbildungen auf Tafel
29.
F. Klein's Apparat zum Dämpfen von Hüten.
Das Dämpfen der Filzhüte wird meist in der Weise vorgenommen, daſs dieselben auf
Holzformen aufgezogen und auf diesen in einem sogen. Dekatirapparate (vgl. F. Meyner 1885 258 378) der
Wirkung gespannten Wasserdampfes ausgesetzt werden. Abgesehen davon, daſs hierbei
der Dampf nur von auſsen auf die Hüte einwirken kann, so besteht bei Benutzung von
Holzformen der Uebelstand, daſs das Holz Wasser aufsaugt, welches beim Heizen des
Apparates verdampft und solchermaſsen von innen auf den Filz einwirkt und leicht
Blasen zieht o. dgl. Um diesen Uebelstand zu beheben, bringen F. Klein und Comp. in Liegnitz (* D. R. P. Kl. 41 Nr.
38804 vom 4. Juli 1886) einen Dämpfapparat zur Ausführung, bei welchem Siebformen zum Aufspannen der Hüte benutzt werden und
der Dampf von beiden Seiten, auſsen und innen,
einwirken kann.
Um die Bedienung des in Fig. 5 Taf. 29
dargestellten Apparates zu erleichtern, wird ein liegender Kasten mit einem
fahrbaren Röhrengestelle angewendet. Die mit Rollen r
auf einem Schienengeleise laufende Thür B dieses
Dämpfkastens A gehört gleichzeitig diesem Gestelle an,
so daſs mit dem Abziehen der Thür vom Kasten auch das in letzterem ebenfalls auf
Rollen fahrbare Röhrengetheil R ausgezogen wird. Das
Gestell R setzt sich aus vier in der Mitte des Kastens
A über einander liegenden Röhren h zusammen, auf welchen unmittelbar mittels
Abzweigungen c die Mundstücke d aufgesetzt sind. Alle Mundstücke stehen durch die Röhren b und c mit der durch die
Thür B nach auſsen reichenden Rohrleitung o in Verbindung, welche, wenn der Apparat geschlossen
ist, bei n mit dem Dampfrohre l gekuppelt wird. Auf diese Weise wird allen Mundstücken d gleichzeitig Dampf zugeführt. Ein vom Rohre l abzweigender Rohrstrang m dient zur unmittelbaren Dampfeinführung in den Kasten A, welcher in bekannter Weise mit Sicherheits- und
Luftventil, Manometer u.s.w. versehen ist.
Die Vorrichtung zum Aufspannen der
Hüte ist in Fig.
6 und 7 Taf. 29 veranschaulicht. Auf das Mundstück d kommt zuerst der mit Glasschmelz überzogene Blechstern e, in dessen Schlitzen mittels Flügelmuttern die
Nadelhaken h stellbar sind. Ueber diesen Stern wird auf
das Mundstück die aus Kupferblech gefertigte Siebform g
gesteckt, welche einen Schalenboden f zum Auffangen von
Dampfwasser besitzt. Der auf die Form g gestülpte Hut
i wird mit seinem Krampenrande an die Haken h genadelt und letztere dann zum Anspannen der Krampe
radial nach auſsen gestellt.
Die Anordnung des Röhrengestelles mit den in entsprechender
Entfernung von einander
stehenden Mundstücken d gewährt den Vortheil, daſs
jeder Hut vor der Berührung mit anderen Filzen und dadurch gegen Ansetzen von
Flecken geschützt ist.
Tafeln