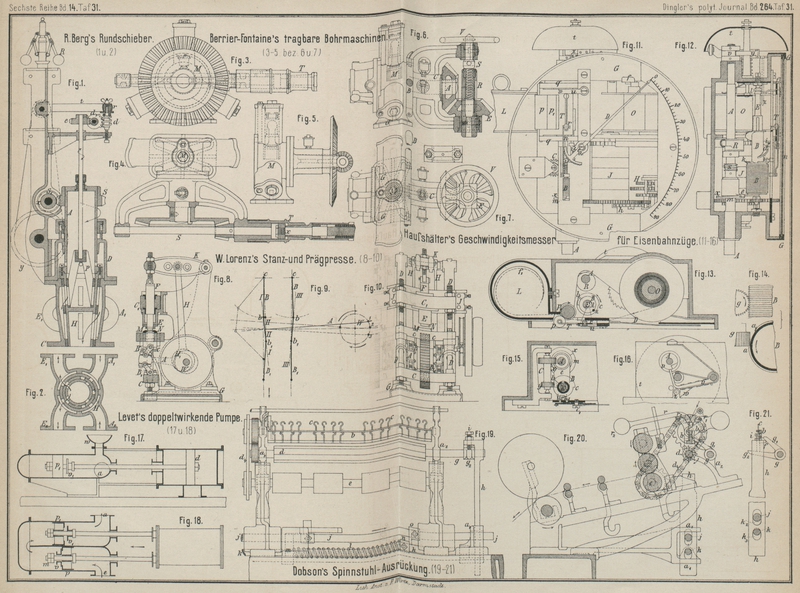| Titel: | Levet's doppeltwirkende Pumpe. |
| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 541 |
| Download: | XML |
Levet's doppeltwirkende Pumpe.
Mit Abbildung auf Tafel
31.
Levet's doppeltwirkende Pumpe.
Die in Fig. 17
und 18 Taf.
31 dargestellte doppeltwirkende Pumpe von Levet
arbeitet mit zwei Ventilen und mit zwei neben einander liegenden Kolben p, p1
, welche von einem mit doppelter Kolbenstange
versehenen Dampfkolben d bewegt werden. Die
Pumpencylinder mit Saugrohr- und Druckrohransatz e
bezieh. a sind in einem Stücke gegossen und enthalten
die Ventile v, v1
welche an der Kolbenstange verschiebbar sind. In der Zeichnung ist die Bewegung der
Kolben nach links angenommen; es wird mithin durch p
Wasser aus der Leitung e angesaugt und zugleich Wasser
nach a gedrückt. Der Kolben p1 verhält sich dabei unwirksam und läſst
das Wasser einfach durchströmen. Bei der umgekehrten Bewegung ist v1 geschlossen, v geöffnet, der Kolben p1 saugt und drückt zugleich, während p vom Saugwasser durchströmt wird.
In Folge der beständigen Strömung des Wassers sind die
hydraulischen Stöſse vermindert oder nahezu beseitigt, wozu der Windkessel w noch mitwirkt. Das Wasser kommt auch beim Hubwechsel
nicht zum Stillstande; denn aas Ventil v kann sich
schon vor Ende des Hubes, sobald die Geschwindigkeit fies Kolbens kleiner wird als
die des Wassers, durch die lebendige Kraft des letzteren öffnen, und v1 wird sich erst beim
Rückgange der Kolben schlieſsen, wenn deren Geschwindigkeit gröſser geworden ist als
die des Wassers. Beim Hubwechsel sind daher beide Ventile gleichzeitig offen und die
Wasserlieferung kann
gröſser werden als die theoretische, dem Producte aus Kolbenfläche, Hub und Habzahl
entsprechende, wie es auch bei anderen schnell umlaufenden Pumpen vorkommt. Die
Dampfmaschine hat eine Anschlagsteuerung, da keine Welle vorhanden ist.
Statt die Kolben an den Kolbenstangen fest und die Ventile
verschiebbar zu machen, kann man auch die umgekehrte Einrichtung treffen, welche
noch wirksamer sein dürfte. Denkt man sich das Ventil v1 in der gezeichneten Stellung und v an die Muttern m
befestigt, dagegen die Kolben verschiebbar, so wird von a her Wasser gesaugt und nach e gedrückt. Für
die Kolben läſst sich übrigens jede beliebige Hubpumpenkolben-Construction
verwenden. Nachtheilig ist der Umstand, daſs das Wasser vier rechtwinkelige
Krümmungen durchströmen muſs, ferner daſs zwei Kolbenstangen vorhanden sind, wodurch
die Aufstellung und Einrichtung der Pumpe erschwert wird, und daſs endlich der
Hauptwiderstand stets nur auf eine der beiden Kolbenstangen wirkt, während der
Dampfdruck auf die Kolbenfläche gleichförmig vertheilt ist, daher eine Neigung zur
Drehung des Dampfkolbens um einen zur Ebene der beiden Kolbenstangen senkrechten
Durchmesser entsteht, welchem Bestreben durch gröſsere Stärke dieser Stangen und
durch sorgfältige Befestigung derselben am Kolben entgegengewirkt werden muſs. (Nach
den Comptes rendus de la Société de l'Industrie minérale de
St. Etienne, Mai 1886, durch die Oesterreichische
Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, 1887 * S. 147.)
Tafeln