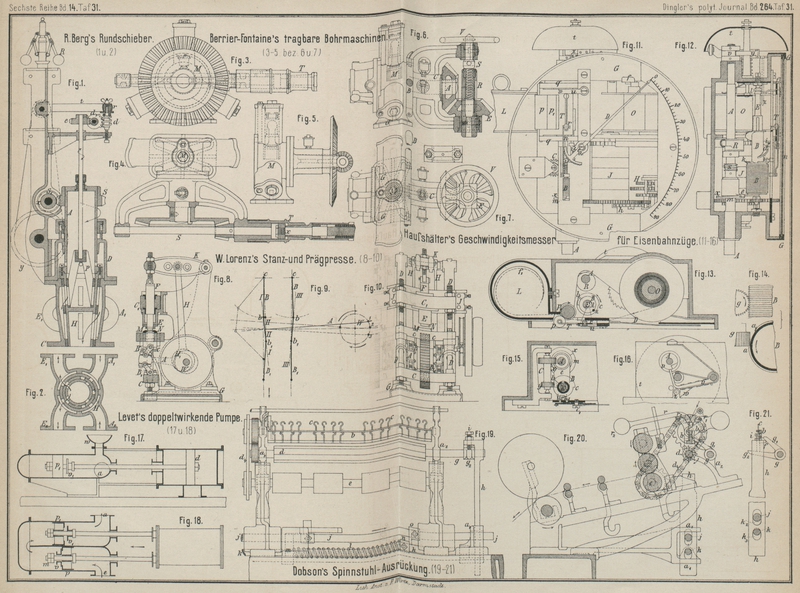| Titel: | B. A. Dobson's selbstthätige Ausrückvorrichtung für Spinnstühle. |
| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 549 |
| Download: | XML |
B. A. Dobson's selbstthätige Ausrückvorrichtung für
Spinnstühle.
Mit Abbildungen auf Tafel
31.
Dobson's selbstthätige Ausrückvorrichtung für
Spinnstühle.
Fig. 19 bis
21 Taf.
31 veranschaulichen bei einem Dublirstuhl für Kammgarn
eine selbstthätig wirkende Ausrückvorrichtung bei Fadenbruch, welche nach B. A. Dobson's englischem Patente 1885 Nr. 11246 von
der Maschinenfabrik Dobson und Barlow in Bolton
neuerdings ausgeführt wird. Bei derselben wird nicht wie gewöhnlich bloſs die zu dem
gerissenen Faden gehörige Lieferung und die Spindel in ihrer Weiterbewegung
aufgehalten, sondern es wird vielmehr beim Reiſsen eines Fadens die ganze Maschine
durch Verschiebung des Antriebriemens auf die Losscheibe abgestellt und gleichzeitig
die Stelle bezeichnet, an welcher der Fadenbruch stattgefunden hat.
Die aus Draht gebogenen Fadenfühler c hängen senkrecht
frei beweglich in der ⊏-Schiene b, welche in einzelnen
Stücken von der Länge der Maschinenabtheilungen ausgeführt wird und mit Endzapfen in
den Lagerstelleisen a2
hängt, worin sie nach rückwärts ausschwingen kann. Auf ihrer Rückseite besitzt die
Schiene b eine Nase f
(Fig.
21), auf welche sich ein auf der Achse g
festsitzender Finger g1
legt. Die durch die ganze Maschinenreihe reichende Achse g trägt an dem einen Ende einen Finger g2, auf welchen sich, wie aus Fig. 19 rechts zu
entnehmen ist, die Stellschraube i am oberen Ende der
in dem Arme at
senkrecht geführten Schiene h stützt. Die Schiene h besitzt am unteren Ende zwei verschieden lange
Schlitzlöcher k2 und
k3; durch das obere
längere Schlitzloch k3
reicht die mit der Führungsgabel für den Antriebriemen der Maschine verbundene
Ausrückstange; und durch das untere kürzere Schlitzloch k3 kann bei entsprechender Stellung der
Schiene h eine Stange k
hindurch treten. Die Stange k erhält durch eine
aufgesteckte, gegen das am Maschinengestelle feste Auge m sich legende und von dem Stellringe n
gespannte Feder l das Bestreben, stets durch die
Schiene h zu stoſsen und dabei, indem sich der
Stellring n gegen die Stellnase o auf der Stange; legt, die letztere in der in Fig. 19 angegebenen
Pfeilrichtung zu bewegen und folglich die Maschine auszurücken, wird aber hieran
durch die Schiene h gehindert. Laufen nämlich alle
Fäden in der Maschine, werden also durch dieselben alle Fadenfühler in die Höhe
gezogen, so steht die Schiene b senkrecht und durch die
gegenseitige Auflage von g1 auf f und von i auf g2
nimmt die Schiene h eine solche Stellung ein, daſs der
Steg zwischen den beiden Schlitzlöchern k2 und k3 vor dem Kopfende der Stange k steht. Reiſst aber ein Faden, so senkt sich der
zugehörige Fadenfühler c und dessen unteres Ende tritt
zwischen die Zähne der beständig umlaufenden Welle d,
welche von dem unteren Zuführcylinder e aus durch die
Gelenkkette d1 und ein
Stirnrad Vorgelege in Drehung versetzt wird. Die Zahnleisten der Welle d suchen nun das zwischengetretene Drahtende des
gefallenen Fadenfühlers mitzunehmen und die Schiene b
schwingt in Folge dessen nach rückwärts aus. Dabei wird durch die Nase f die Achse g gedreht und
durch den Finger g2 die
Schiene h gehoben, so daſs die Stange k durch das Schlitzloch k3 treten und die Maschine abstellen kann.
Um nun die Stelle des Fadenbruches sofort erkenntlich zu machen, ist an dem einen
Ende der Schiene b noch eine schräg nach oben
gerichtete Nase b2
angegossen und auf dieselbe legt sich die Nase c1 eines um den Zapfen r1 drehbaren Hebels r, welcher für gewöhnlich von dem festen Zapfen r3 an dem
Lagerstelleisen a2
unterstützt wird. Wenn jedoch die Schiene b nach hinten
ausschwingt, wird der Hebel r durch die Nase b2 ausgehoben. In
dieser gehobenen Stellung bleibt der Hebel r stehen,
weil die durch die Schiene h getretene Stange k das Senken derselben und somit das Zurückgehen der
Schiene b verhindert; die gehobene Stellung der Scheibe
r2 am Ende von r zeigt somit den Ort an, wo der Fadenbruch
stattgefunden hat. Durch das Verharren der Schiene b in
ausgeschwungener Stellung ist auch das Ende des gefallenen Fadenfühlers c aus dem Bereich der Zahnwelle d gekommen und wird so vor Abnutzung und Beschädigung durch letztere
bewahrt.
Tafeln