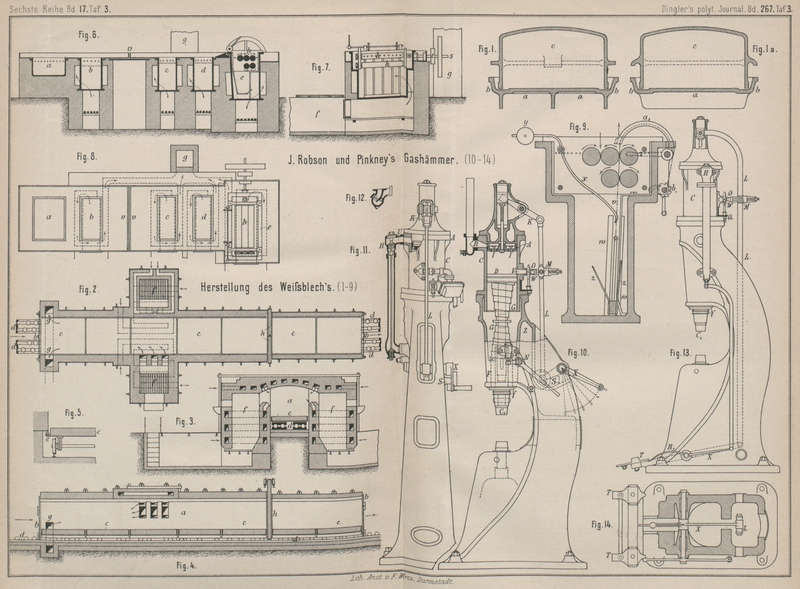| Titel: | J. Robson und Pinkney's Gashammer. |
| Autor: | Pregél |
| Fundstelle: | Band 267, Jahrgang 1888, S. 12 |
| Download: | XML |
J. Robson und Pinkney's Gashammer.
Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 3.
Robson und Pinkney's Gashammer.
Diese seit dem J. 1885 bekannten Hämmer befinden sich in den Cornwall Works in
Birmingham in stetiger Verwendung und zeichnen sich durch die Billigkeit ihres
Betriebes sehr vor den Dampfhämmern aus (vgl. Robson
1887 264 * 591). Auch sind Neuerungen an Gashämmern zu
verzeichnen, die bei der Wichtigkeit dieses Werkzeuges für den Kleinbetrieb
Beachtung verdienen.
Nach der Revue générale des machines outils, 1887 * S.
77 ist bei den in Fig. 10 bis 14, Taf. 3 dargestellten
Gashämmern der Explosionscylinder C auf dem
Hammergestell derart hoch aufgesetzt, daſs die zum Hochheben des Hammerbärs
dienende Doppelspiralfeder G zwischen der
Kolbenstangenführung und dem Druckkolben D Platz
findet. Durch zwei im Hammergestell vorgesehene Seitenöffnungen (Fig. 13) entweicht die
beim Niedergang des Hammers verdichtete Luft aus dem Federgehäuse, während eine
Spiralfeder Y die Hubbegrenzung des Hammers im Aufstieg
mildert. An der oberen Hubstellung des Druckkolbens D
tritt durch eine Oeffnung V in der Cylinderwandung
Leuchtgas und Luft ein, deren Zufluſs durch einen Mischungshahn geregelt wird, wobei
an dieser Oeffnung eine durch ein Kegelventil O
verdeckte Zündflamme W die Explosion des Gasgemisches
veranlaſst. Dieser Kegelverschluſs O wird durch einen
Keil M zurückgestellt, welcher an der Steuerstange L angebracht ist, und nur in der tiefsten Lage
derselben in Wirksamkeit tritt. An dieser Steuerstange L ist mittels eines Doppelhebels K ein Kolben
A angelenkt, welcher die Aufgabe eines
Steuerungsorganes oder eines Saugkolbens erfüllt. Ist nämlich der Handhebel X in die Lage 1 eingestellt, so liegt der Steuerkolben
A beinahe am Druckkolben D auf, der Hammer befindet sich in seiner Ruhelage.
Wird dagegen der Handhebel X nach 5 umgelegt, wobei der
Vorsprung S als Anschlag dient, so schlieſst der
Steuerkolben A in seiner Hochstellung die
Austrittsöffnung R, saugt aber während seiner Bewegung
beständig Gas und Luft an, welches den Raum zwischen den beiden Kolben A und D erfüllt. Sobald
aber der Steuerkolben die Hubgrenze erreicht, wird durch den Keil M die Zündflamme freigelegt, die Explosion des
Gasgemisches und der Niederfall des Druckkolbens D mit
dem Hammerbär C1
veranlaſst, während durch die beiden Kolbenventile II
eine vollständige Druckausgleichung am Steuerkolben herbeigeführt wird. Erfolgt nun
die Umsteuerung, also die Niederführung des Steuerkolbens A, so wird die Oeffnung R für den Austritt
der Explosionsgase frei, welche durch den sich wieder erhebenden Hammerkolben
förmlich ins Freie gepreſst werden. Es muſs daher der Mischungshahn für die
Einströmung mit einer Rückschlagklappe versehen sein.
Um aber eine Aenderung der Schlagstärke des Hammers herbeizuführen, kann dieses wohl
nicht durch eine geringere Hubhöhe des Steuerkolbens erreicht werden, was offenbar
einer, der kleineren Füllung zukommenden, kleineren Gasmenge entsprechen würde, weil
der Entzündungsmoment von der Höchststellung des Steuerkolbens A, bezieh. der Tieflage des Ausrückkeiles M abhängt und eine Aenderung nicht thunlich
erscheint.
Deshalb wird zwar das zu einem vollen Hub gebrauchte Gasgemisch zugeleitet, dieses
aber während oder gleich nach der Explosion in einem gröſseren Raum expandirt,
wodurch natürlich der Mitteldruck geringer, dementsprechend die Schlagstärke
schwächer wird. Zu diesem Behufe wird der Cylinderraum unter dem Steuerkolben durch
eine Oeffnung U mittels eines Seitenrohres in Verbindung mit einem
geschlossenen Raum Z im Hammergestell gebracht, diese
Zuleitung aber durch ein Ventil H geregelt, dessen
Stange durch das Zwischenrohr auf einen Handhebel N
sich stützt. Hiernach würde für jede Schlagstärke immer die gleiche Gasmenge
gebraucht, was aber nur ausnahmsweise gebraucht und bei der Billigkeit des
Betriebsmittels bedeutungslos erscheint.
Textabbildung Bd. 267, S. 14 Einen Gashammer mit Fuſshebelsteuerung stellt Fig. 13 und 14 dar, worin
XT der Tritt für die Hubsteuerung des Kolbens A, und R1 der Tritthebel für Regelung, bezieh. Abminderung
der Schlagstärke ist.
In dem in der Textfigur gezeichneten Indicatordiagramme stellt die vollgezogene Linie
a die Expansionscurve einer, in einer kalten
Maschine stattgehabten, Explosion dar, während die strichpunktirte Linie b ein Arbeitsdiagramm darstellt, welches bei
angewärmtem Cylinder nach 200 Schlägen aufgenommen worden ist. Der mittlere Druck
stellt sich auf pm =
1,57, bezieh. 1k/qc,42. Da nun das Hammergewicht 36k
beträgt, der Cylinderdurchmesser von 179mm eine
Kolbenfläche von 250qc ergibt, der Hammerkolben
152mm, der Steuerkolben 127mm Hub besitzt, so folgt daraus ein
Arbeitsvermögen von 56 bezieh. 50km für jeden
einzelnen Hub. Der Gasverbrauch stellt sich daher bei einem annähernden
Mischungsverhältniſs von 10 : 1, Luft zu Leuchtgas auf 30l für 100 Hübe, woraus je nach den örtlichen
Gaspreisen der Betriebsaufwand dieses Gashammers leicht berechnet werden kann.
Pregél.
Tafeln