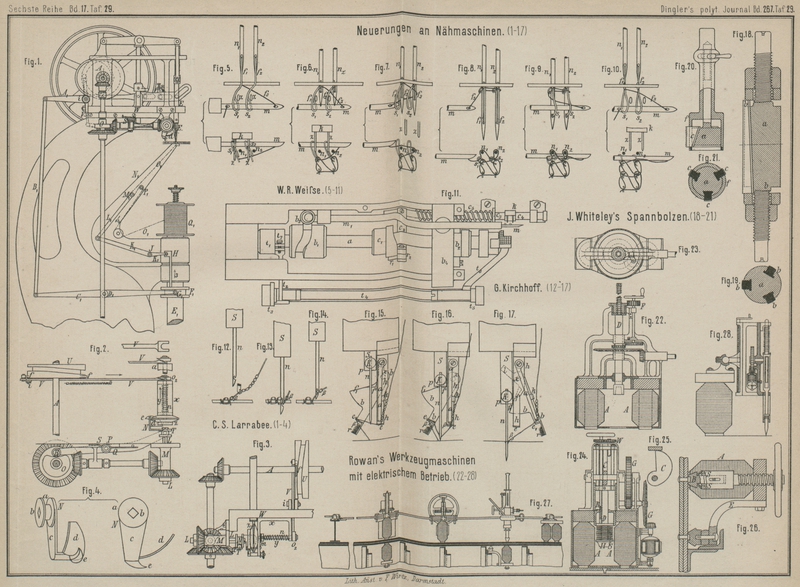| Titel: | Ueber Neuerungen an Nähmaschinen. |
| Autor: | H. G. |
| Fundstelle: | Band 267, Jahrgang 1888, S. 577 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.
(Patentklasse 52. Fortsetzung des Berichtes Bd.
264 S. 368.)
Mit Abbildungen auf Tafel
29.
Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.
Doppelstich-Nähmaschine für Lederwaaren; von C. S. Larrabee in Frankfurt a. M. Diese Nähmaschine (*
D. R. P. Nr. 42012 vom 1. März 1887) arbeitet mit einer Hakennadel, welche sich in
einer senkrechten Ebene bewegt und einem um eine horizontale Achse rotirenden
Greifer (Schlingentransporteur) N (Fig. 1 bis 4 Taf. 29), welcher die
von der Hakennadel durch den Stoff gezogene Fadenschlinge aufnimmt und über die den
zweiten Faden enthaltende ruhende Spule z führt, welche
aus zwei gewölbten, kreisrunden Metallplatten besteht, die in ihrer Mitte durch
einen Steg verbunden sind, auf welchen der Faden bezieh. Pechdraht gewickelt wird
und welche Spule zwischen den Backen l und m (Fig. 3) des unter der
Platte W angebrachten Lagerbockes x vollständig auſser jeder Verbindung mit einem anderen
Theil liegt.
Der gleichfalls in dem Bock x verschiebar gelagerte
Bolzen y ist von einer Feder n umgeben, durch welche derselbe gegen die Spule z gepreſst wird, so daſs diese, zwischen dem Bolzen y und dem Backen eingeklemmt, sich nicht bewegen kann.
Das andere aus dem Lagerbock x hervorstehende Ende des
Bolzens y ist mit der an der einen Seite abgeschrägten
Fläche o2 versehen.
Hinter dieser Abschrägung liegt das gleichfalls keilförmig zulaufende Ende des
Winkelhebels V (Fig. 2), welches auſserdem
eine Gabel bildet, so daſs es sich über den Bolzen y
schieben kann. Macht nun der Winkelhebel die in Fig. 2 angegebene
Verschiebung, veranlaſst durch die auf der Curvenscheibe U sitzenden Nasen f, so wird er, wie in Fig. 2
angegeben, den Bolzen y zu einer Verschiebung in seinen
Lagern veranlassen und zwar in der durch den Pfeil angegebenen Richtung, wodurch
dessen Druck auf die Spule z aufgehoben und letztere
nunmehr ganz frei wird.
Der Schlingentransporteur N sitzt verschiebbar auf dem
aus der Lagerung M vorstehenden vierkantigen Theil der
Welle L und macht mit dieser während eines Nadelhubes
zwei Umdrehungen. Die Verschiebung des Greifers auf der Welle L erfolgt von der Curvenscheibe O aus, gegen welche das mit der Rolle R
versehene Ende des um den Punkt P drehbaren Hebels Q durch die Feder S
gedrückt wird. Das andere Ende des Hebels Q ist mit
einer Rolle T versehen, welche in eine ringförmige Nuth
des Greifers N eingreift, so daſs sich dieser auch
während seiner zweimaligen Umdrehung bei der entsprechenden, durch die Hubscheibe
O veranlaſsten Bewegung des Hebels Q auf der Welle L von
links nach rechts oder umgekehrt verschiebt.
Die Construction des Schlingentransporteurs N ergibt
sich aus der Fig.
4, welche denselben in perspectivischer Ansicht, sowie von der Seite
gesehen zeigt. In der Mitte der mit der ringförmigen Nuth versehenen Muffe a befindet sich eine der Stärke der Welle L
entsprechende viereckige Oeffnung b, mit welcher der
Greifer auf die Welle L aufgeschoben wird. Der mit
dieser Muffe aus einem Stück bestehende, unten winkelig umgebogene Arm c erweitert sich wieder, aufwärts gehend, zu einer Art
Schaufel d, auf welcher sich unten ein spitzer, an
seiner Basis jedoch sehr breiter Haken e ansetzt.
Die Stichbildungswerkzeuge functioniren in folgender Weise:
Hat die Hakennadel E den zu vernähenden Stoff
durchstochen und bringt bei ihrem Aufwärtsgange den Faden, welcher um den Haken der
Nadel eine kleine Schleife bildet, mit, so kommt der Greifer N und schiebt mit dem schaufeiförmigen Theil d den zwischen Spule und Stoff befindlichen Faden, durch welchen der
letzte Stich gebildet ist, bei Seite, so daſs die Spitze des nunmehr nahe an die
Nadel herangetretenen Hakens e ungehindert in die von
dem Haken der Nadel gebildete Fadenschleife eintreten kann. Bei der weiteren
Umdrehung nimmt nun der Schlingentransporteur die Schleife von der Nadel ab und ganz
auf und führt sie um die in diesem Augenblick durch Verschiebung des Winkelhebels
V von jedem Druck befreite Spule z. Ist dieses geschehen, so verschiebt sich der Greifer
in Richtung seiner Drehachse von rechts nach links, um der Nadel bei ihrem nächsten
Niedergang nicht im Wege zu sein und die Schleife von dem Haken e abzuwerfen.
Der Anzug des Stiches erfolgt durch den aus Fig. 1 ersichtlichen
Mechanismus. Eine auf der Antriebswelle befindliche Excenter- oder Curvenscheibe
wirkt auf die durch Gelenk mit einander verbundenen Hebel A1, B1, C1. Ersterer ist ein Winkelhebel und hat bei i seinen Drehpunkt, während der doppelarmige Hebel C1 bei D1 seinen Drehpunkt
hat. Die an dem einen Ende des Hebels C1 angebrachte Gleitrolle G1 greift in eine rinnenförmige Nuth der
auf der vertikal stehenden Welle E1 verschiebbar angebrachten Muffe F1, deren auf und ab
gehende Bewegung dann durch das Stück H auf den um den
Punkt J drehbaren Hebel R1 übertragen wird. Letzterer ist durch
ein Gelenk mit dem Stück L1 verbunden, an welchem sich oben eine kleine Rolle M1 befindet, um welche
der Faden O1 von der an
dem Hörn N1 drehbar
fest angebrachten Rolle P1 bezieh. von der Spule Q1 aus zur Arbeitsstelle geführt wird. Wird durch die
auf der Arbeitswelle A befindliche Excenter- bezieh.
Curvenscheibe in Verbindung mit den combinirten Hebeln A1, B1 und C1 die Muffe F1 bezieh. das Stück H
zu einer Bewegung in Richtung des Pfeiles 3 veranlaſst,
so macht das mit dem Winkelhebel K1 durch ein Gelenk verbundene Stück L1 eine abwärts gehende
in der Richtung des Pfeiles 4 erfolgende Bewegung,
wodurch dann ein Anziehen des Fadens O1, also des Stiches bewirkt wird.
Nähmaschine zur Herstellung von zwei oder mehr parallelen
Steppnähten, von Wilhelm Richard Weiſse in
Dresden. Wenn man, wie bisher, zwei oder mehrere parallele Steppnähte
dadurch erzeugt, daſs man Schleifen der oberen Fäden durch ein senkrecht zur Nahtrichtung laufendes
Schiffchen verriegelt, so kann man die Gleichmäſsigkeit der Steppstiche auf der
oberen Stoffseite schwer erzielen, weil die oberen Fäden mit ungleicher Kraft von
dem unteren Faden zurückgehalten werden.
Aus diesem Grunde wird bei der Maschine von Weiſse (* D.
R. P. Nr. 41787, vom 17. Juni 1887) die Verriegelung der oberen Fadenschleifen s1
s2 (Fig. 5 bis 10 Taf. 29) mittels einer
horizontalen, zur Nahtrichtung senkrecht sich bewegenden Nadel m bewirkt, in welche nahe der Spitze ein Faden f3 eingezogen ist und
welche mit den oberen Nadeln n1
n2 derart zusammen
arbeitet, daſs sowohl die senkrechten Nadeln an der horizontalen Nadel, als auch die
letztere vor den senkrechten Nadeln n1
n2 auf der Seite
vorbeistechen, welche der fertigen Naht zugekehrt ist.
Die Fig. 5 bis
10 Taf.
29 stellen die Entstehung der Nähte dar.
Nachdem die oberen Nadeln n1
n2 nach oben aus dem
Stoff zurückgezogen sind (Fig. 5) greift der Kamm
k, der so viel Zähne z
besitzt, als parallele Nähte neben einander hergestellt werden sollen, zwischen die
auf der Nadel m hängenden Schleifen s1
s2 und schiebt
dieselben so weit zur Seite, daſs die Nadeln n1
n2 beim nächsten Stich,
auch bei sehr enger Nadelstellung, mit Sicherheit daneben stechen (Fig. 6).
Während die Nadeln n1
n2 tiefer gehen, zieht
sich der Kamm k und die Nadel m zurück, wobei letztere ihren Faden, der von den Schleifen s1
s2 umfaſst wird (Fig. 7), um die
Nadeln n2 schlingt.
Bevor die Nadel m sich wieder vorwärts bewegt, rückt
dieselbe in der Nahtrichtung so viel zur Seite, daſs ihre Bahn zwischen die fertige
Naht und die oberen Nadeln zu liegen kommt (Fig. 8), und die Schleifen
s1
s2 ziehen sich in Folge
der Niederbewegung der oberen Nadeln so weit zusammen, daſs sich der Faden f3 auch um die Nadel
n1 schlingt.
Sobald die Nadeln n1
n2 so weit
zurückgegangen sind, daſs ihre Fäden f1
f2 sich lockern, sticht
die Nadel m an den oberen Nadeln vorbei und dringt mit
ihrem Faden in die Schleifen s1
s2 ein (Fig. 9), so daſs beim
Rückgang der oberen Nadeln die Schleifen auf der Nadel m hängen bleiben.
Haben die Nadeln n1
n2 den Stoff verlassen,
so wird letzterer um eine Stichlänge weiter gerückt und es hat sich so ein zweites
Glied der Naht dem in Fig. 6, 7, 8 und 9 dargestellten ersten
Glied angefügt (Fig. 10).
Schlieſslich rückt die Nadel m in der Nahtrichtung zur
Seite und der Kamm k bringt die Schleifen wieder in die
in Fig. 6
gezeichnete Stellung, worauf das Spiel von Neuem beginnt.
Der Bewegungsmechanismus für die Stichbildungswerkzeuge ist aus Fig. 11 ersichtlich. Die
Hauptwelle a, von welcher aus durch Excenter der die senkrechten
Nadeln tragende Arm bewegt wird, trägt die Curvenscheiben b1
b2 von denen b1 unter Vermittelung
des Hebels b3 die
Nadelstange m1 der
Nadel m senkrecht zur Nahtrichtung verschiebt und b2 dieselbe seitwärts
rückt.
Die gleichfalls auf der Hauptwelle befestigte doppelte Hubscheibe c1 wirkt auf die beiden
Rollen r1
r2 des Hebelarmes c2 ein und veranlaſst
durch diesen die Bewegung der Welle c3 in der Weise, daſs der durch Arm c4 mit ihr verbundene
Kamm k die für die Stichbildung erforderliche Bewegung
erhält.
Die Feder c5 drückt die
beiden Rollen r1
r2 gegen die Hubscheibe
c1.
Die Excenter t1 und t7 bewirken in
bekannter Weise die Bewegung des Stoffschiebers t6, indem t7 den mit einem Lappen auf ihm ruhenden
Stoffschieberarm t6
hebt und das Excenter t1 unter Vermittelung der Theile t2
t3
t4
t5 den Fortschub
bewirkt.
Nähmaschine zum Aufnähen von Perlen; von G. Kirchhoff in Berlin. Das Aufnähen von Perlen mit
Hilfe der Maschine erfolgte bisher in der Weise, daſs man die Perlschnur durch
Zickzacknähte auf dem Stoff befestigte; es wurde also ein besonderer
Befestigungsfaden benutzt und abwechselnd vor und hinter der Perlschnur dieser Faden
mit dem Stoff verbunden.
Bei der in den Fig.
12 bis 17 Taf. 29 dargestellten Maschine von G.
Kirchhoff (* D. R. P. Nr. 42236 vom 5. Juni 1887) wird nun der Perlfaden
direkt zur Stichbildung verwendet und zwar mit Hilfe einer mit nach unten
gerichtetem Haken ausgestatteten Nadel durch den Stoff geführt. Mit dieser Nadel ist
der Nadelfaden nicht immer verbunden, sondern wird von derselben beim Abwärtsgang in
Folge der Stoffverschiebung selbstthätig gefangen (Fig. 14) und nach jedem
vollendeten Stich wieder frei gegeben, um die Perle an den eben fertig gestellten
Stich gelangen zu lassen (Fig. 12).
Die Transport Vorrichtung für die Perlen (Fig. 15 bis 17) besteht im
Wesentlichen aus einem feststehenden Perlhalter h und
zwei oscillirenden Hebeln, dem Perlabtheiler a und dem
Perlschieber b, welch letzterer eine Bürste r trägt und federnd achsial verschiebbar auf der
Drehachse x sitzt. Dieser Perlschieber b ist mit den schrägen Flächen ff1 ausgerüstet und hat den Ansatz l. Der Perlabtheiler besitzt den nach hinten
gerichteten Mitnehmer k.
Die beiden Arme bh sind an ihrem Ende umgebogen und bei
ee1 V-förmig
ausgeschnitten und zwar stehen sich die Ausschnitte mit ihren offenen Seiten
gegenüber.
Die Wirkung der Transportvorrichtung ist nun folgende: Bei hoch stehender Nadel n wird der Arm b nach
links bewegt, da der Kopf V des Nadelschlittens (Fig. 15) den
Lappen l zurückdrückt. Beim Niedergang der Nadel trifft
der Nadelschlitten S gegen die schräge Fläche f und drückt den achsial verschiebbaren Arm b zuerst so weit achsial zurück, daſs derselbe an der
Nadel bei seiner später auszuführenden Schwingung vorübergehen kann. Schlieſslich
trifft bei der Niederbewegung des Schlittens S der
Knopf K der Nadelbefestigung gegen die schräge Fläche
f1 und bewirkt eine
Schwingung des Armes b nach der Seite. Derselbe gelangt
somit in die in Fig. 16 gezeigte Stellung. Bei dieser Schwingung nimmt der Arm b mittels des Mitnehmers h
den Arm a mit nach rechts.
Durch dieses Ausschwingen der Arme a und b ist erstens die Perle β,
welche zwischen dem feststehenden Arm h und dem
Abtheiler a stand und gehalten wurde, nach unten hin
von h frei geworden, und zweitens ist der Faden aus dem
Einschnitt e1 des Armes
b herausgeschlüpft, so daſs die Perle β sich frei nach unten bewegen und unter den Einschnitt
e1 gelangen
kann.
Beim Hochgehen der Nadel n erfolgt dann nach der
Freigabe des Perlfadens gleichzeitig das wieder nach links Schwingen des Armes b (mittels des Armes l,
der Hebel a folgt durch die Fadenspannung) und die
Bürste r führt dabei die Perle β an der Nadel vorbei und hält sie in der Stellung Fig. 15. Damit ist ein
Stich vollendet und der Vorgang beginnt von Neuem.
H. G.
Tafeln