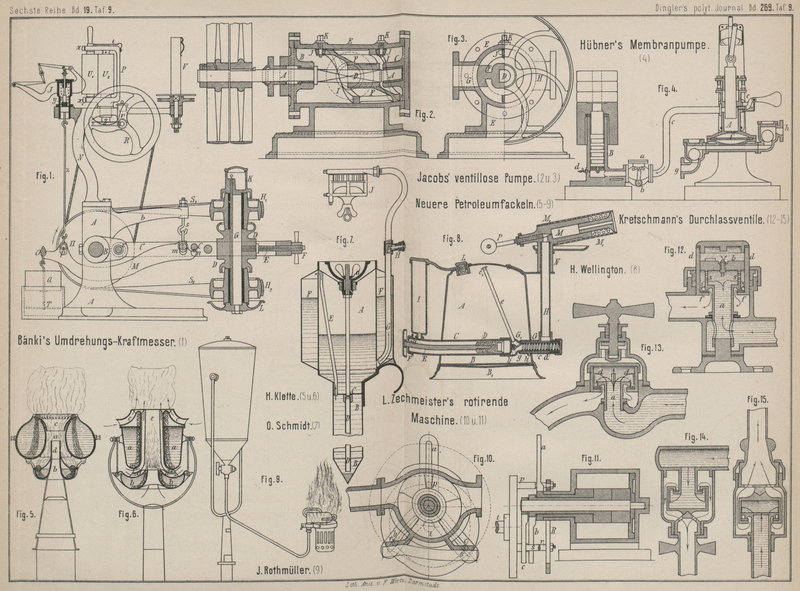| Titel: | Rotirende Maschine von Ludwig Zechmeister in München. |
| Autor: | Stn. |
| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 154 |
| Download: | XML |
Rotirende Maschine von Ludwig Zechmeister in
München.
Mit Abbildungen auf Tafel
9.
Zechmeister's rotirende Maschine.
Die rotirende Maschine von Ludwig Zechmeister in München
(*D. R. P. Kl. 59 Nr. 43250 vom 14. Oktober 1887) besitzt einen Cylinder, in welchem
sich drei Kolben concentrisch hinter einander bewegen. Die Achsen dieser Kolben sind
central in einander gesteckt und übertragen die Bewegung der Kolben entweder nach auſsen,
wenn die Maschine als Motor dient, oder von auſsen nach innen, wenn dieselbe als
Arbeitsmaschine, Pumpe, Gebläse o. dgl. benutzt wird. Die Uebertragung geschieht mit
Hilfe von Kurbeln ohne Anwendung von Zugstangen in folgender Weise:
1) Die an der Achse der Kolben befestigten Kurbeln werden entsprechend verlängert und
mit Schlitzen versehen, in welchen die Kurbelzapfen der excentrischen Achse gleiten.
Diese Schlitze können geradlinig, und zwar radial zum Achsmittel oder geneigt oder
auch nach irgend einer Curve gekrümmt sein. Das Krümmen oder Schiefstellen der
Schlitze geschieht zu dem Zwecke, die Bewegung der Kolben stellenweise noch mehr zu
beschleunigen oder zu verzögern, was insbesondere bei expandirenden oder zu
comprimirenden Gasen u. dgl. wünschenswerth ist; oder
2) die letztgenannten Zapfen der Triebwelle sind drehbar und haben Schlitze, in
welchen die geraden oder die gekrümmten Kolbenkurbeln gleiten; oder
3) an Stelle von nur einem solchen Zapfen sind deren je zwei in hinreichender
Entfernung angebracht, zwischen welchen die erwähnten Kolbenkurbeln gleiten können;
oder
4) die Kolbenkurbeln sind so construirt, daſs sie sich verlängern und verkürzen
lassen, indem ein Theil der Kurbel auf dem anderen oder in Schlitzen des anderen
gleitet, wie es die excentrische Bewegung der Triebachsenkurbeln verlangt.
Durch Einschaltung von Federn in die Transmission werden die eventuellen Stöſse in
der Bewegung der einzelnen Theile vermindert oder gänzlich beseitigt.
Der Zweck dieser Einrichtungen ist, die Spannungen zu beseitigen, die durch die
Zugstangen, namentlich bei stark excentrischer Lage der Triebachse, entstehen.
Die Bewegungsübertragung nach 1) geschieht in folgender Weise: Die Schlitze der
Kolbenkurbeln abc (Fig. 10 und 11 Taf. 9)
nehmen die Zapfen prs der Triebachskurbeln (oder eines
entsprechenden Schwungrades oder einer Scheibe), die auf die Triebachse t aufgekeilt sind, in sich auf.
Die Kolbenkurbeln sind der Anschaulichkeit halber als hinter einander angeordnet
gezeichnet. Durch eine leichte Abkröpfung an dem inneren Ende können sie derart
abgeändert werden, daſs sich die geschlitzten Theile in einer und derselben Ebene
bewegen, wodurch die Zapfen gleich construirt werden können. Die Zapfen selbst
können durch die Schlitze genügend weit hinausreichen und an ihren Enden mit
einander durch einen Ring R verbunden werden. Bei
erfolgender Drehbewegung gleiten die Zapfen in den Schlitzen abc der Kurbeln, wodurch die eigenthümliche, abwechselnd beschleunigte
oder verzögerte Bewegung der Kolben hervorgebracht wird. Durch die excentrische Lagerung der
Kolbenachsen zu der Triebachse ergeben sich Differenzen der Hebellängen von Kraft
und Last, welche hier viel klarer hervortreten als bei den bisherigen
Constructionen. Bei geraden, radialen Schlitzen ergibt sich eine vollkommen
symmetrische Bewegung, wie sie bei Verwendung von nicht zusammendrückbaren
Flüssigkeiten unbedingt nothwendig ist. Will man dagegen eine stärkere Expansion
durch vermehrte Entfernung der Kolben, so kann man die Schlitze statt radial,
geneigt oder nach irgend einer gewünschten Curve herstellen, wodurch natürlich der
Gang der Maschine unsymmetrisch wird und die gewünschte Maximalleistung nur nach
einer Richtung zu erzielen ist, wonach dann auch entsprechend die Gröſse und Lage
der Ein- und Ausströmungsöffnungen zu bemessen ist.
Hiernach lassen sich die unter 2) bis 4) angegebenen Einrichtungen leicht übersehen
(vgl. auch 1888 268 * 203, rotirende Maschine von Jac. Weber in Neuötting am Inn).
Stn.
Tafeln