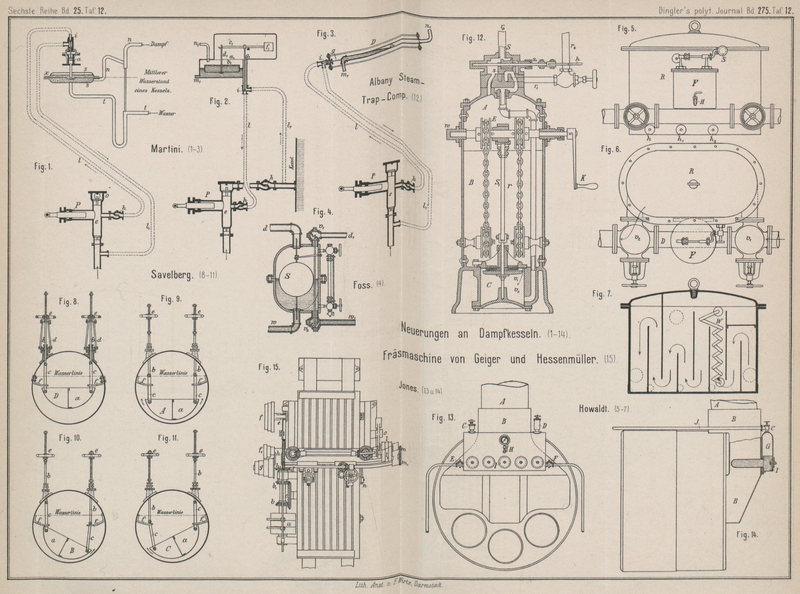| Titel: | Ueber Dampfkessel; von Prof. H. Gollner in Prag. |
| Autor: | H. Gollner |
| Fundstelle: | Band 275, Jahrgang 1890, S. 241 |
| Download: | XML |
Ueber Dampfkessel; von Prof. H. Gollner in
Prag.
(Fortsetzung des Berichtes S. 60 d.
Bd.)
Mit Abbildungen auf Tafel
12.
Gollner, über Dampfkessel.
Eine Neuerung an selbsthätigen Dampfkessel-Speiseapparaten mit Schwimmern wurde von
Georg Hammer in Bulmcke bei Gelsenkirchen (D. R. P.
Nr. 34742 vom 17. April 1885) angegeben, um im Bedarfsfalle eine gröſsere Wassermenge als der freie Raum in der
Schwimmerkammer zuläſst, auf einmal in den Kessel
einzuführen, durch welches Verfahren die Nachtheile der unregelmäſsigen
Kesselspeisung – während des Betriebes desselben – zur Geltung kommen müssen.
Die von Hermann Martini in Chemnitz (D. R. P. Nr. 37504
vom 7. Oktober 1885) angegebenen Einrichtungen zur Regelung der Speisung von
Dampfkesseln unter Anwendung a) eines besonderen Dampfentwicklers, b) eines
Schwimmers und c) eines sogen. Dehnrohres verdienen eine besondere Erörterung.
ad a), b), c) Die Vorrichtungen bezwecken, die Wirkung der Kesselspeisepumpe,
entsprechend dem einzuhaltenden regelmäſsigen Wasserstande, zeitweilig ganz oder
theil weise zu unterbrechen. Zu diesem Zwecke ist der schädliche Raum der
Speisepumpe P entweder mit der Saugleitung l1 oder mit der
Druckleitung l durch ein Rohr verbunden. Die
Wasserbewegung in den Leitungen l und l1 kann mit Rücksicht
auf das angeordnete Rückschlagventil nur in je einer bestimmten Richtung erfolgen.
Die Unterbrechung der Wasserbewegung erfolgt mittels des Ventils i durch einen der im Folgenden beschriebenen
Apparate.
ad a) Fig. 1.
Ein Dampfentwickler z steht in der Höhe des mittleren
Wasserstandes des Betriebskessels, welcher selbsthätig gespeist werden soll. Unter
der Bodenfläche von z befindet sich der Hohlraum s, welcher durch n mit dem
Dampfraume, durch t mit dem Wasserraume des
Betriebskessels in Verbindung steht.
Sinkt der Wasserstand in demselben unter den regelmäſsigen, so füllt sich s theilweise mit Dampf, welcher die Flüssigkeit in z zum Sieden bringt, wodurch eine gewisse Dampfspannung
in z entsteht. Diese Spannung wirkt auf den Kolben a, der sich nach auſsen bewegt und das Ventil i schlieſst.
Steigt das Wasser über den regelmäſsigen Stand, so füllt sich s vollständig mit Wasser. Das Gefäſs x kühlt
sich ab, es sinkt in z die Spannung, der Kolben a bewegt sich im entgegengesetzten Sinne, i wird eröffnet. Bei geschlossenem Ventil i ist die stets bethätigte Pumpe P auf Kesselspeisung durch o wirksam, im Gegenfalle muſs P leer laufen,
d.h. es findet ein Kreislauf des Pumpenwassers durch h,
l und i und mittels l1 nach e
statt, ohne daſs eine Kesselspeisung eintreten kann.
ad b) Fig. 2.
Ein Gefäſs a1 ist durch
n1 mit dem
Dampfraume, durch m1
mit dem Wasserraume des zu speisenden Kessels in Verbindung, wobei wieder der Wasserstand in
a1 in der Höhe des
regelmäſsigen Wasserstandes im Betriebskessel liegt. In das Becken b1 Im Gefäſse a1 sickert aus n1 Wasser nieder,
welches ersteres regelmäſsig bis zur halben Höhe in den Wasserkörper von a1 taucht und durch das
Gegengewicht f1 am
Hebel c1 in seiner
regelmäſsigen Lage erhalten wird. Je nach Ueber- oder Unterwasserstand in b1 wird mittels der
angedeuteten Wage (Schwimmervorrichtung) und dem Gestänge g1 das bekannte Ventil i gehoben und geschlossen, d.h. die Speisung des
Betriebskessels eingeleitet oder abgestellt. Die angedeutete Schwimmervorrichtung ist sehr empfindlich und daher die ganze Einrichtung
bei gutem Zustande des Ventils i sicher wirksam.
ad c) Fig. 3.
Das „Dehnrohr“ o1 liegt etwas geneigt in
der Höhe des regelmäſsigen Wasserstandes des zu speisenden Dampfkessels; n1 und m1 verbinden o1 bezieh. mit dem
Dampf- und Wasserraume des Kessels. Bei hohem Wasserstande ist o1 mit mehr gekühltem
Wasser gefüllt, zieht sich daher zusammen und öffnet das Ventil mittels g: der Schluſs desselben Ventils erfolgt bei der
Ausdehnung von o1 in
Folge der gröſseren Dampffüllung in demselben.
Die volle bezieh. verminderte Wirksamkeit oder die zeitweilige Abstellung der Pumpe
P wird durch die veränderliche Gröſse der Eröffnung
und den zeitweilen vollen Schluſs des Ventils i
selbsthätig vermittelt.
Die Anordnung nach Ingenieur Joly (Engineering, 1886 S. 247, D. R. P. Nr. 37026 vom 2.
Februar 1886) zeigt auch die Anwendung eines Sei;wimmers, dessen Bewegungen aber zur
Drehung einer wagerechten in der Kesselstirnwand
abgedichteten Welle ausgenutzt wird. Diese
Drehbewegung wird mittels Lenker auf das Ende eines wagerechten Hebels übertragen,
der bestimmt ist, einen gedichteten Plungerkolben zu
heben und senken und derart das gelieferte Pumpenwasser mehr oder weniger als
Rückwasser in ein Saugreservoir oder als Speisewasser in den Kessel zu leiten. Der
Plunger befindet sich in einem Dreiwegestutzen, der in die Druckleitung der
Speisepumpe eingeschaltet ist. Die Anordnung wird je nach dem Zustande der zwei hier
vorkommenden Stopfbüchsen eine veränderliche
Empfindlichkeit zeigen, in welchem Umstände ein wesentlicher Nachtheil begründet
ist. Daſs die ganze Einrichtung auch zur Anzeige des niedersten oder höchsten
Wasserstandes im Dampfkessel mittels Dampfpfeifen oder Contacte ausgenutzt werden
kann, ist nicht von Wesenheit.
Es sei noch der Speisewasserregulator von L. P. Foſs aus
Kalamazoo (Scientific American, 11. December 1886),
sowie die in derselben Zeitschrift (2. April 1887) behandelte Anordnung eines
Speiseregulators nach Wyman erwähnt.
Die letztere Anordnung, in Fig. 4 dargestellt,
besteht aus dem Schwimmer S, dessen Kammer durch d mit dem Dampfraume, durch w
mit dem Wasserraume des
zu speisenden Betriebskessels in Verbindung steht; d1 führt Dampf aus der Sehwimmkammer (Kessel) zur
Dampfpumpe, w1 Wasser
von dieser in den Kessel. Die beiden Ventile v1 und v2 werden mittels des sofort aus der Figur
ersichtlichen Gestänges (ohne Stopfbüchse) bei eingetretenem Ueberwasserstande in
Folge Erhebung von S gleichzeitig geschlossen, wodurch
die Dampfpumpe abgestellt wird. Bei Eintritt eines Unterwasserstandes, d. i. Senkung
von S, werden beide Ventile v1 und v2 gleichzeitig geöffnet und die Dampfpumpe
bethätigt. Die Einrichtung ist noch mit einem Wasserstandszeiger, auch mit einem
Manometer ausgerüstet. Die Einrichtung ist in der That durch groſse Einfachheit,
Empfindlichkeit, daher Zuverlässigkeit ausgezeichnet und hat sich nach den mit
demselben erledigten Versuchen bewährt.
Gustav Stoff in Berlin liefe sich ein Verfahren und eine Vorrichtung patentiren (D. R. P. Nr. 36313 vom 27. Januar 1886), um bei Speisung von
Dampfkesseln den regelmäſsigen Wasserstand selbsthätig zu erhalten, wobei aber nach
Bedarf eine gröſsere Wassermenge, als verdampft wird, zugeführt werden muſs; das
überschüssige Wasser wird weiter mittels Steigrohr und Abschäumbecken in Verbindung
mit einem Ablaufrohre behufs Entfernung der durch die Speisung in den Kessel
gelangten Kesselsteinbüdner abgeführt. Das Ablaufrohr steht mit einem beliebigen,
das Wasser vom Dampfe trennenden Apparate zur Verhütung des Dampfaustrittes aus dem
Kessel in Verbindung. Dieser Wasserabscheider steht weiter mit einem Vorwärmer und
einem besonders ausgebildeten Wasserauslaſsventil in Verbindung, um sowohl den
Spannungsabfall als auch den Wärmeverlust nach auſsen zu vermeiden, damit eine
möglichst hohe Temperatur des Speisewassers erzielt werde.
An die eben vorgeführten Speiseregulatoren für Dampfkessel mögen weiter noch einzelne
Hilfseinrichtungen für diese hervorgehoben werden,
welche in besonderen Fällen von entschiedenem Nutzen sein werden. Der Zweck dieser
Einrichtungen ist im Allgemeinen ein sehr verschiedenartiger, die constructive
Durchführung derselben von der Art und Gröſse des Dampfkessels abhängig, für welchen
sie bestimmt sind. Aus der Reihe der „Speisewasserreiniger“ sei die Anordnung von Gebrüder Howaldt in Kiel (D. R. P. Nr. 24021 vom 2. December 1885)
hervorgehoben, deren Anordnung aus Fig. 5 bis 7 zu ersehen ist. Die
Einrichtung hat den Zweck, dem Speisewasser die mitführende Luft, fettige Bestandtheile sowie Schmutztheile zu entziehen, ist daher besonders für Maschinen mit
Oberflächencondensation geeignet. Der Apparat wird in das Speiserohr R1 eingeschaltet und
zwar derart, daſs eine Ausschaltung desselben ohne Störung der Kesselspeisung
gesichert ist. Zu diesem Zwecke sind die Doppelsitzventile v1 und v2 zu schlieſsen, während das Speisewasser
unmittelbar durch das Rohr D flieſst. Die Luft wird dem Speisewasser durch
ein selbsthätiges Schwimmventil entzogen, wodurch zunächst eine Ursache der
Zerstörung der Kesselbleche entfällt.
Die Fette werden durch den Schaumhahn S zeitweise
abgelassen oder es wird eine besondere Einrichtung zur Fettentnahme angebracht,
welche aus dem Fettstoffe F besteht, nach welchem das
durch die Wärmeschlange W (Fig. 7) erhitzte Fett
abflieſst und durch den Hahn H entfernt werden kann.
Schmutztheile werden während des Betriebes durch die Hähne h0 bis h3 oder anläſslich der Hauptreinigung der Kammer R entfernt. Die beschriebene Einrichtung ist besonders
für Schiffskessel bestimmt und für diese erfahrungsgemäſs bewährt.
Josef Savelberg in Stolberg (D. R. P. Nr. 33561 vom 2.
Mai 1885) führt einen verstellbaren Kesselstein und Schlammfänger für Dampfkessel
aus, welcher aus einem Blechtroge nach Fig. 8 bis 11 besteht, der sich über
da; Feuerblech oder über den ganzen Kesselboden erstreckt und während des
Kesselbetriebes mittels abgedichteter Stangen (Schienen) verstellbar ist. Die
Wirkung dieses Fängers beruht auf den in seinen verschiedenen Stellungen
hervorgebrachten verschiedenen Strömungen des Kesselwassers zwischen Fänger und
Kesselwand. Das Erglühen und Beulenziehen der Kesselwandungen soll dadurch vermieden
werden, daſs durch die künstlich erzeugte Strömung der abgesprungene Kesselstein und
Schlamm im Entstehen über den Rand des Blechtroges und in diesen hineingeworfen
werden. Der Fänger erhält während der ersten Woche einer Betriebsperiode die
Stellung A (Fig. 9), während der
folgenden Zeit jeden Tag mehrmals abwechselnd die Stellungen B (Fig.
10) und C (Fig. 11). Bei
Auſserbetriebsetzung des Kessels erhält der Fänger die Stellung D (Fig. 8).
Die Albany Steam Trap Company in Albany, Nordamerika,
führt nach dem Amerikanischen Patente Nr. 352944 eine Einrichtung zur Reinigung von
Dampfkesseln aus. Die Unreinigkeiten im Kessel sollen mittels einer stetigen
Wasserströmung entfernt werden, welche zwischen dem Kessel und einem besonderen
Reinigungsapparate (Filter) und von diesem zurück zum Kessel eingeleitet wird. Der
Hauptbestandtheil der ganzen Einrichtung ist ein Filterkörper., der mit jedem
Betriebskessel in einfacher Weise in Verbindung gebracht werden kann. Es handelt
sich darum, dem Filter das verunreinigte (Kesselsteintheilchen enthaltende)
Kesselwasser zuzuführen, dasselbe durch die Filtrirmasse unter der Wirkung des
Kesseldampfdruckes zu drängen, und aus dem Filterkörper gereinigt dem Kessel
zuzuführen, endlich die in der Filtermasse angesammelten Verunreinigungen durch
einen Gegenwasserstrom zu entfernen und aus dem Filterkörper zu bringen und derart
die Filtrirmasse wieder wirkungsfähig zu machen. Der Filterkörper ist in Fig. 12 im
Längsschnitte dargestellt. Derselbe besteht aus den cylindrischen Räumen A, gefüllt mit zu reinigendem Kesselwasser, B der Filtrirmasse (Sand) mindestens 500mm hoch gehalten und der Kammer C im untersten Theile des ganzen Körpers angeordnet, in
welcher sich bereits gereinigtes Kesselwasser befindet. Dieses wird durch ein Rohr
r dem Schieberkasten S
zugeführt und durch die Leitungen r1 und r2 wieder in den Dampfkessel zurückgebracht. Das
gereinigte Kesselwasser tritt am vorderen Ende des Kessels wenige Centimeter unter
dem niedersten Wasserspiegel in den Wasserkörper, während das zu reinigende Wasser
an der rückwärtigen, tiefst gelegenen Kesselstelle abgenommen und durch die Leitung
r0 dem Filter
zugeleitet wird. Im Schieberkasten befindet sich der Muschelschieber s (in der äuſsersten Rechtslage gezeichnet), welcher
durch das Gestänge s1
mit Hebel h bethätigt wird. Für diese Schieberstellung
ergibt sich die Arbeitsperiode des ganzen Apparates; das unreine Wasser tritt durch
r0 ein, strömt
unter Druck durch A, durch die Sandschichte in B, ferner durch C, nachdem
es gereinigt das Ventil v1 (Sandventil genannt) verlieſs, ferner durch die Leitung r und die Schiebermuschel nach r1. r2 zum Kessel. Das Ventil v1 ist in eigenthümlicher Weise ausgeführt
und hat den Zweck, die Durchgangskanäle zwischen B und
C für das bereits gereinigte Wasser zu liefern. Die
nöthige Reinigung dieser Kanäle erfolgt durch die lothrechte Bewegung der mit
Stiften versehenen Ventilplatte v1 mittels S1 gegen die feste, aber durchlöcherte Ventilplatte
r2 unter Ausnutzung
des aus der Figur ersichtlichen Bewegungsmechanismus, der im Wesentlichen aus der
Welle w mit Kurbel k, dem
Excenter E und der unten geführten Excenterstange S1 besteht. Die Weiten
der Oeffnungen in der Ventilplatte v2 sind derart bemessen, daſs zwischen deren
Wandungen und den Stiftenumflächen in v1 ein genügend freier Querschnitt für die
erforderliche Wasserströmung bleibt.
Wird der Schieber s in die äuſserste Linksstellung
gebracht, so kann behufs Reinigung des Ventils sammt Filters ein kräftiger
Gegenstrom des Wassers erzeugt werden, durch welchen die bezeichneten
Verunreinigungen mittels eines Hilfsrohres vom Filterkörper abgeleitet werden.
Industries, 1887 S. 116., beschreiben eine dem Ingenieur
C. Jones in Liverpool patentirte Einrichtung zum
Verdampfen von salzigem Seewasser.
Durch die in den Fig. 13 und 14 dargestellte
Einrichtung soll der Ersatz an Wasserverlusten durch Schiffsmaschine und Kessel
während langer Seefahrten geschaffen werden. Sie besteht aus einem Verdampfer für
Seewasser, welcher in die Rauchkammer des Schiffskessels eingebaut wird, und dessen
Inneres mit dem Oberflächencondensator der Maschinenanlage in Verbindung gesetzt
wird. Der Verdampfer G ist mit einer Anzahl einseitig
abgeschlossener Gefäſse in Verbindung, welche mit Seewasser gefüllt, in die
Rauchkammer B des Schilfskessels versenkt werden. Der
sich in G entwickelnde Dampf wird – wie erwähnt – in den
Oberflächencondensator durch J strömen gelassen; D stellt ein Sicherheitsventil für G dar, durch die Leitung E
wird das zu verdampfende Wasser dem Verdampfer zugeführt., mittels F wird der Verdampfer entleert; die Anordnung der
Putzlucken J gestatten die Uebersicht und vollständige
Reinhaltung der bezeichneten Einrichtung.
Für eine Schiffsmaschine von 500 indicirter Pferdekraft erhielt der Verdampfer 2qm,5 Heizfläche und war bestimmt für den Tag 180
Gallonen Seewasser zu verdampfen. Die Einrichtung ist durch groſse Einfachheit der
Anordnung ausgezeichnet, gestattet die Verdampfung des Seewassers wegen der
bestehenden Luftverdünnung im Condensator bei etwa 90° C. und ist geeignet, die
Wärme der abziehenden Rauchgase entsprechend auszunutzen.
Eine ähnliche, für denselben Zweck, d. i. für Gewinnung des sogen. Extrawassers zum
Trinken, für die Schiffskessel u.s.w. bestimmte Einrichtung beschreibt The Engineering, 1886 S. 305, welche für den
Schraubendampfer Bentinck zur Ausführung kam. Sie wurde vom Ingenieur C. Jones des St. Georges
Works in Liverpool entworfen, und war bestimmt in 24 Stunden 2000 Gallonen
reines Wasser zu liefern. Der Verdampfer ist der gröſseren Entwicklung der Anlage
wegen als Röhren Verdampfer ausgeführt, dessen Reinigung mittels eines Ejectors
erfolgt. Die Verdampfung des Seewassers findet gleichfalls im luftverdünnten Raume
statt und erfolgt unter der Einwirkung der durch die Rauchkammer abziehenden
Rauchgase.
Tafeln