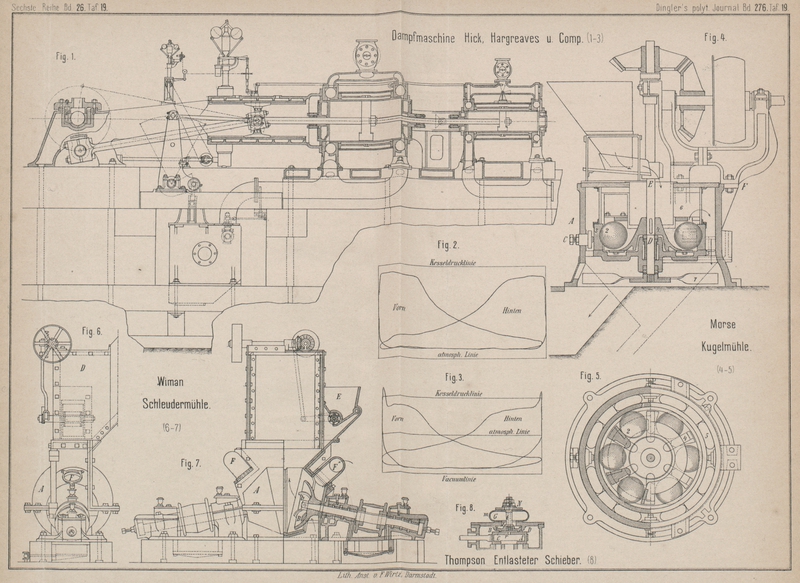| Titel: | Ch. Morel's Kugelmühle. |
| Autor: | Pr. |
| Fundstelle: | Band 276, Jahrgang 1890, S. 345 |
| Download: | XML |
Ch. Morel's Kugelmühle.
Mit Abbildungen auf Tafel
19.
Morel's Kugelmühle.
Zur Vermahlung spröder Körper wie Cement, Gyps, Schwerspat, Schlacken, Kalk, Erze
u.s.w. werden in neuerer Zeit mit Vortheil Kugelmühlen an Stelle von Mahl- und
Kollergängen verwendet. Obwohl dieselben zur Zerkleinerung von Holz- und Steinkohle
für Gieſsereizwecke schon seit vielen Jahren gebraucht wurden, so haben diese
Maschinen doch erst in dem letzten Jahrzehnt eine weiter gehende Ausbildung
erfahren, wodurch nicht nur die Leistungsfähigkeit derselben beträchtlich
gesteigert, sondern auch die Gleichartigkeit des Mahlgutes erhöht wurde. Vor den
Kollergängen, namentlich aber vor den französischen Mahlgängen haben die Kugelmühlen
insofern einen wesentlichen Vorzug, als ihre arbeitenden Theile weniger der
Abnützung unterworfen sind und daſs ferner ihre Bauweise die Anlage der
Sichtvorrichtungen ermöglicht, wodurch Nebenmaschinen in Wegfall kommen können.
Die Kugelmühlen bestehen im Allgemeinen aus einer um wagerechte Hohlzapfen kreisenden
Blechtrommel, in welcher eine gröſsere Anzahl eiserner Kugeln sich befinden, die
durch Ueberstürzen und Rollen das eingeführte Mahlgut zerstoſsen und zerreiben. Je
nach der Härte und Beschaffenheit des Mahlgutmateriales richtet sich die Ausführung
des Trommelmantels, welcher aus gelochtem oder geschlitztem Stahlblech oder aus
rostartigen Stahl- bezieh. Hartguſsstäben gebildet ist, während auſserdem noch zur
Schonung des feinen Siebgeflechtes gröbere Vorsiebe eingeschaltet werden, um das
unvollkommen gebliebene Mahlgut als Uebergang abzuscheiden, welches hierauf mittels
geeigneter Vorkehrungen in die Maschinentrommel zur weiteren Verarbeitung
zurückgeführt wird.
Ueber Kugelmühlen vgl. Villeroy 1886 259 * 15, Zimmermann * 301,
Grusonwerk 1889 274 *
398 bezieh. Jenisch * 397, SachsenbergIn der Zeitschrift des Vereins deutscher
Ingenieure, 1890 Bd. 34 Nr. 15 * S. 358 bezieh. 1886 * S. 333,
ist die Kugelmühlenanlage der Mansfelder Kupferschiefer Senden
Gewerkschaft in Eisleben ausführlich beschrieben. 1890
275 * 353.
Wesentlich von den vorerwähnten abweichend ist die von Ch.
Morel in Grenoble gebaute Kugelmühle, welche nach Revue générale des machinesoutils, 1889 Bd. 3. Nr. 6 * S. 42, in Fig. 4 und 5 dargestellt
ist. Dieselbe besteht aus einem guſseisernen Standgefäſs A, in welchem mittels vier Stellschrauben C
ein Stahlring 3 centrisch festgehalten wird, an dessen
hohlgedrehter Innenwand die Kugeln 2 zum Theil
eingreifen. Diese Kugeln werden durch die mit 180 bis 200 minutlichen Umläufen
kreisende Fächerscheibe 4 mitgenommen und vermöge der
auftretenden Fliehkraft nach dem Ring 3 mit
entsprechendem Druck gepreſst, welcher weitaus gröſser als das Eigengewicht der
Kugeln ist. Ein auf die Fächerscheibe 4 aufgeschraubter
flacher Schluſsring verhindert nicht nur das Herausfliegen der Kugeln, sondern
besorgt hauptsächlich den Nichtigen Umlauf des Mahlgutes, während durch den unteren
Deckelring das Einlegen der stählernen Treibplatten erleichtert wird, welche zur
Schonung der Fächerflügel vorgesehen sind. Das vom Rumpf 1 durch den Rüttelschuh E fallende Gut
gelangt durch das am Zargendeckel befestigte Rohr in die einzelnen Fächer der
Kugelscheibe 4, unter die Kugeln und dann zwischen
diese und den feststehenden Ring 3, wo es durch die von
der Kugelfliehkraft bedingte Druckäuſserung und auſserdem durch die Reibungswirkung
der rollenden Kugeln zerrieben wird.
Das durch den zwischen Zargendeckel und Stahlring 3
eingerannten Siebcylinder 6 geworfene Mahlgut fällt
durch Oeffnungen 5 im Gefäſsboden nach dem Flügelwerk
6, welches die Fortschaffung des Mahlgutes bezieh.
die Lüftung der Maschine besorgt.
Die Anordnung des Triebwerkes und die Lagerung der Fächerspindel D sind aus den Figuren leicht zu beurtheilen. Als
Arbeits- oder Wirkungslinie kann mindestens die untere Hälfte des Berührungsbogens
einer Kugel
angesehen werden, so daſs bei sechs Kugeln eine sechsfache Länge derselben ganz wohl
angenommen werden kann.
Mit dieser Kugelmühle soll das Feinmahlen von Cement, Kalk u. dgl. Stoffe erfolgreich
durchgeführt worden sein und die Leistung im Vergleich zu einem Kollergang das Zwei-
bis Vierfache betragen, während ununterbrochener Betrieb, Schutz gegen Verstaubung,
gute Lüftung mittels Saugwind leicht durchführbar sind.
Pr.
Tafeln