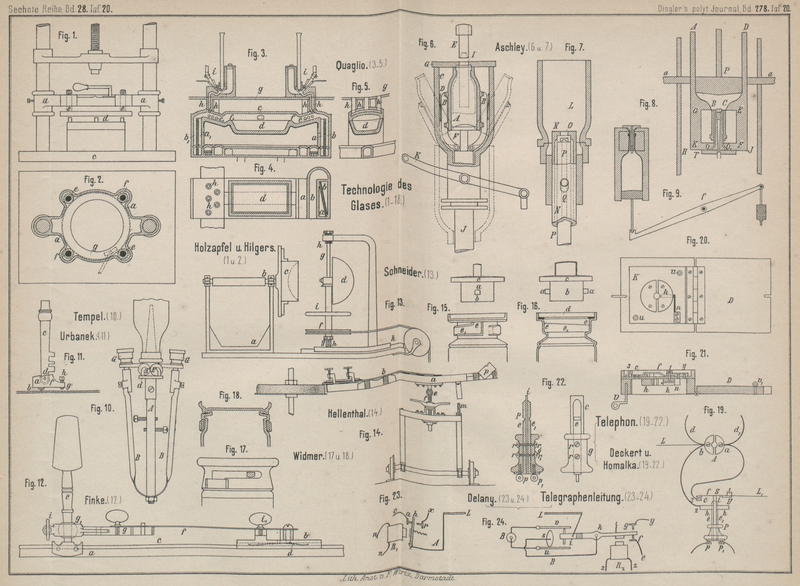| Titel: | Deckert und Homolka's Telephon-Einschaltvorrichtung für Eisenbahn-Wächterhäuser. |
| Fundstelle: | Band 278, Jahrgang 1890, S. 346 |
| Download: | XML |
Deckert und Homolka's
Telephon-Einschaltvorrichtung für Eisenbahn-Wächterhäuser.
Mit Abbildungen auf Tafel
20.
Telephon-Einschaltvorrichtung für
Eisenbahn-Wächterhäuser.
Mittels der unterm 8. März 1890 für Deckert und Homolka
in Wien in Kl. 21 für Oesterreich-Ungarn patentirten Einschaltvorrichtung läſst sich
in einfacher und bequemer Weise ein von dem Zugführer eines Eisenbahnzuges
mitgebrachtes Telephon und Mikrophon, behufs Verständigung von einem Wächterhause
aus nach den benachbarten Bahnstationen, oder von einem Wächterhause aus zu irgend
einem anderen, in eine Läutewerksleitung einschalten.
Fig. 19 zeigt
die schematische Verbindung des Einschalters S. Der
Strom der Signalleitung kommt bei L an, geht über die
Klemme b des Läutewerksausschalters A durch die Windungen des in den Draht d, d1 eingeschalteten
Elektromagnetes des Läutewerks und dann nach der Klemme a des Ausschalters, von hier nach dem Contactpunkt c3 und im normalen Zustande über die Feder f,
die gewöhnlich auf c aufliegt, nach der Klemme y1 in die Leitung L1 weiter.
Soll jedoch das Telephon und Mikrophon eingeschaltet und gesprochen werden, so wird
der Doppelstöpsel P bis zum Anschlag in das Loch des
Einschalters S gesteckt. In diesem Falle ist, wie in
Fig. 19,
die Contactfeder f von c
abgehoben und der Strom nimmt folgenden Lauf:
Von der Leitung L1 über
die Platte b des Ausschalters A nach der Platte h von S, über die Stöpselhälfte e des Stöpsels P und von p aus nach der Platte und dem Kohlenklotze des
Mikrophons, durch die zwischen p und p1 eingeschaltete primäre Wickelung des Inductors in
die Stöpselhälfte e1,
über die Platte k und das Stück y1 weiter nach L1.
In diesem Falle sind die Elektromagnetwindungen des Läutewerks ausgeschaltet und der
Strom der beiden benachbarten Stationsbatterien erregt die primäre Spirale des
Mikrophoninductors, dessen secundäre Spirale ihre inducirten Ströme durch die
Elektromagnet Wickelung des Telephons sendet.
Fig. 20 zeigt
den Einschalter in einem festen eichenen Kästchen K mit
Plombenverschluſs v, v1: D ist der Deckel des offenen Kästchens,
welches mittels zweier durch die Löcher u, u gesteckter
Holzschrauben an den Läutewerkskasten angeschraubt wird; h und k sind zwei mit einem Loche versehene
halbkreisförmige Metallplatten, welche mit Holzschrauben am Boden des Kästchens
befestigt werden. Die zweite k trägt einen
Ansatzkörner, der mit seiner kegelförmigen Spitze in das runde Loch der Platten
hineinragt, wie es der Durchschnitt (Fig. 21) sehen läſst.
Dieser Körner wird durch die Feder n stets nach dem
Loche hingedrückt, er hat in eine Vertiefung des Doppelstöpsels P einzuschnappen und diesen so vor dem Hinausdrängen
aus dem Loche der Platten k, h durch die Feder f zu schützen. Die Platte y trägt die Contactfeder f und die
Verbindungsschraube 1, die zugleich mit k in leitender Verbindung ist; die Contactplatte c trägt einen Platincontact, welcher der Feder f gegenübersteht, und eine Verbindungsschraube 3. Ferner besitzt die Platte h die Verbindungsschraube 2, deren Zweck aus
Fig. 19
ersichtlich wird.
Fig. 22 zeigt
den Doppelstöpsel im Längenschnitt und in der Längsansicht.
In einem Hefte g von isolirender Masse sind die beiden
durch ein isolirendes Stück i von einander getrennten
Metallplatten e und e1 mittels der Schrauben rr1 befestigt. Das Stück i ragt sowohl nach oben als auch seitlich vor den
Platten e und e1 hervor. Der oben hervorragende Theil hebt beim
Hineinstecken des Stöpsels in das Loch die Feder f vom
Contact c ab, während die seitlichen Vorsprünge das
Einstecken des Stöpsels nur in zwei Lagen gestatten. Die Oesen p und p1 dienen zur Aufnahme einer doppelten, zum Mikrophon
und Inductor führenden leonischen Schnur.
Die Handhabung des Einschalters erfolgt so: falls ein Zug auf der Strecke liegen
bleibt, so nimmt der Zugführer das in einem Kästchen befindliche Mikrophon sammt dem
an der Doppelschnur hängenden Stöpsel P zum nächsten
Wächterhause mit, dort gibt er am Läutewerk mit dem Läutetaster das Zeichen: „Zug
liegt auf der Strecke“, dann befreit er das dort befindliche Kästchen K von der Plombe und öffnet es, worauf er den Stöpsel
P in das Loch der Platten k und h bis zum Ansatz steckt.
Da obiges Streckenzeichen für den Stationsbeamten die Aufforderung enthält, auch sein Mikrophon
einzuschalten, so kann das Sprechen nach dem gewohnten Anruf erfolgen.
Es können mittels solcher Einschalter und zweier Apparatsätze ganz bequem auch zwei
Wächterhäuser zum Sprechen mit einander verbunden werden.
Tafeln